Hier möchte ich mal eine Thread eröffnen, in dem es nicht unbedingt um Ameisen und andere soziale Insekten geht, aber sehr wohl um Biologie und die Vermittlung biologischen Wissens. Gedacht ist nicht an die reichlich durchgekauten Themen zu Ameisenhaltung, Import, Handel etc., sondern u.a. an Medienprodukte, in denen (mir) immer wieder der Mangel an fundamentalem Bio-Wissen auffällt.
Zum Start hier ein aktuelles Thema, ein Interview mit Peter Wohlleben:
Der Bestseller-Autor und schreibende Forstmann, hat im „Stern“ Nr. 16/2020 vom 8. 4. 2020 einen großen Artikel „Der Frühling ist da. Trotz allem, über das Neuerwachen der Natur- und unser Freiheitsgefühl in Corona-Zeiten“.
Herr Wohlleben mag ein guter Forstmann sein, das kann ich nicht beurteilen. Seine populäre Naturdarstellung verkauft sich bestens. Doch manche seiner Angaben kann ich als Biologe wirklich nicht akzeptieren.
In dem genannten Artikel jedenfalls liest man Folgendes über die Honigbienen:
Nach meinem Wissensstand beginnt die Bienenkönigin erst im Frühjahr, wenn Pollen als Proteinquelle zur Verfügung steht, mit der Eiablage (keinesfalls bereits „um den 21. Dezember“). Wie soll bitte das Volk während der Überwinterung bis zum Frühjahr „wieder zur alten Stärke“ heranwachsen?
Im Winter sitzen die Bienen m. o. w. dicht gedrängt als Wintertraube in den Waben, heizen sich unter Verbrauch des eingelagerten Honigs, jedoch nicht bis auf die zur Brutentwicklung nötige Wärme, und da Winterbienen gegen sechs bis sieben Monate überleben (anders als die Sommerbienen, die nach ca. vier bis sechs Wochen „verbraucht“ sind), können sie im zeitigen Frühjahr bereits genügend Pollen und Nektar eintragen, so dass dann die ersten Eier gelegt und die Larven zu neuen Bienen herangezogen werden können.
Etwas vorher im Text steht über „Schnecken“:
Wenn damit Nacktschnecken, insbesondere die berüchtigten Nacktschnecken (z. B. „Spanische Wegschnecke“) gemeint sein sollten, dürften die sich allenfalls totlachen. Bei mir im Garten half da nur schonungsloses Totmachen. Schließlich vermehren sich solche Tiere, und wenn sie das an einem guten Platz in der Nähe tun, breitet sich der Nachwuchs auch wieder in Richtung des ursprünglichen Gartens aus.
Und falls die hübschen Schnirkelschnecken oder die (ohnehin besonders geschützten) Weinbergschnecken gemeint sein sollten, so kann man die getrost im Garten belassen. Nur wenn es wirklich zu viele werden, kann man sie absammeln, dann aber bitte in einem geeigneten Lebensraum (Gebüsch, Waldrand etc.) aussetzen, wobei die Entfernung keine wesentliche Rolle spielen dürfte.
Auch der folgende Text gefällt mir nicht:
Ich vermisse trotz zahlreicher Medienartikel zu Phytonziden belastbare wissenschaftliche Erkenntnisse zu der Vorstellung, dass es sich dabei so pauschal um „für uns nützliche Substanzen“ handelt: https://de.wikipedia.org/wiki/Phytonzide Phytonzide sind "antibiotische Substanzen, die besonders dem Schutz vor Pathogenbefall dienen, und damit einen integralen Teil des pflanzeneigenen Schutzsystems darstellen“.
Ob diese Substanzen, die Krankheitserreger und Schädlinge der Pflanzen abtöten oder abwehren, für den Menschen wirksam sein können, sei dahingestellt. Dass das modische „Waldbaden“ wirklich der Esoterikecke entwachsen ist, darf man bezweifeln. - Schön und erholsam ist der Aufenthalt im Wald und in der freien Natur zweifellos, auch ohne pseudowissenschaftliche Begründungen!
MfG,
Merkur
Biologische Grundwissen und die Medien
9 Beiträge
• Seite 1 von 1
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9942
Re: Biologische Grundwissen und die Medien
Zumindest zu der Sache mit den Bienen kann ich etwas "Praxiswissen" aus dem Imkerei beitragen. "Es kommt drauf an"! Und zwar auf den Standort bzw. vorallem die Temperatur. Die Saison beginnt zwar in unseren Breiten, wie du richtig beschreibst normalerweise erst im Februar oder März, aber die Bienen-Könniginnen beginnen tatsächlich bei zunehmendem Licht und steigender Temperatur mit der Eiablage im Zentrum der Bienentraube. Dezember scheint mir schon etwas arg früh, aber im Januar ist das leider keine Seltenheit. Hin und wieder berichten Imkerkollegen sogar, dass ihre Bienen "durchgebrütet" hätten. Im Dezember sei noch verdeckelte Brut vorhanden gewersen. Was problematisch ist, für die Varroa-Winterbehandlung. Das ist aber nicht nur für den Imker, sondern vorallem für die Bienen und die Brut ein Problem, denn wenn es wieder zu einem Kälteeinbrüchen/Frost kommt, wird das Brutnest oft aufgegeben. Ein riesen Energieverlust! Sobald die Temperatur, z.B. im Bienenhaus, dauerhaft 6 °C überschreitet, wird die Brut durchgepflegt! Auch dass ist bei den zunehmend milden Wintertemperaturen natürlich ein Problem. Denn die Bienen müssen das Brutnest heizen. Und sie verfügen, wenn überhaupt nur über sehr geringe Pollenvorräte. Zur Larvenaufzucht verwenden die Winterbienen Futtersaft und mobilisieren in ihrem Fettkörper eingelagertes Eiweiss. Was passiert, wenn der Frischpollen länger ausbleibt, liegt auf der Hand...
- 3
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
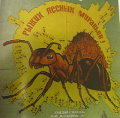
Reber - Moderator
- Beiträge: 1777
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3744
Re: Biologische Grundwissen und die Medien
Hallo Merkur,
sorry, aber ich empfinde die von dir genannten "Fehler", die Peter Wohlleben in seine Texte eingebaut hat, weder als eindeutig genug (siehe auch Rebers Beitrag), noch als so gravierend, als dass es sich lohnen würde, darüber zu berichten.
Aber auf jeden Fall Danke für die Namensnennung des Autors. Ein Anreiz, mir "Das geheime Leben der Bäume" in den nächsten Tagen noch einmal (als Hörbuch) vorlesen zu lassen.
Zu ausgiebigen Waldspaziergängen (Modisch: "Waldbaden") im Allgemeinen: Ob (und inwieweit) Terpene/Phytonzide in der Waldluft sich objektiv messbar positiv auf das menschliche Immunsystem auswirken, bzw. sogar entzündungs- u. krebshemmend sind, lasse ich ebenfalls mal dahingestellt.
Aber subjektiv "spüren" lassen sich diese (und viele weitere) Effekte ja allemal!
Nichts für ungut!
(Vorsatz, ob nun als "Waldbaden", oder als "Waldspaziergang": Öfter mal wieder machen! )
)
--------
Hier noch ein Lesetipp, ein Artikel aus der Zeit, 2018: "Spring! Wer richtig in den Wald eintaucht, tut etwas für seine Gesundheit – in Japan gilt Waldbaden als Medizin. Was sagt die Wissenschaft?" / https://www.zeit.de/zeit-wissen/2018/03 ... ettansicht
sorry, aber ich empfinde die von dir genannten "Fehler", die Peter Wohlleben in seine Texte eingebaut hat, weder als eindeutig genug (siehe auch Rebers Beitrag), noch als so gravierend, als dass es sich lohnen würde, darüber zu berichten.
Aber auf jeden Fall Danke für die Namensnennung des Autors. Ein Anreiz, mir "Das geheime Leben der Bäume" in den nächsten Tagen noch einmal (als Hörbuch) vorlesen zu lassen.
Zu ausgiebigen Waldspaziergängen (Modisch: "Waldbaden") im Allgemeinen: Ob (und inwieweit) Terpene/Phytonzide in der Waldluft sich objektiv messbar positiv auf das menschliche Immunsystem auswirken, bzw. sogar entzündungs- u. krebshemmend sind, lasse ich ebenfalls mal dahingestellt.
Aber subjektiv "spüren" lassen sich diese (und viele weitere) Effekte ja allemal!

Nichts für ungut!

(Vorsatz, ob nun als "Waldbaden", oder als "Waldspaziergang": Öfter mal wieder machen!
 )
)--------
Hier noch ein Lesetipp, ein Artikel aus der Zeit, 2018: "Spring! Wer richtig in den Wald eintaucht, tut etwas für seine Gesundheit – in Japan gilt Waldbaden als Medizin. Was sagt die Wissenschaft?" / https://www.zeit.de/zeit-wissen/2018/03 ... ettansicht
- 0
- Emse
- Mitglied
- Beiträge: 111
- Registriert: Montag 2. Dezember 2019, 14:13
- Bewertung: 181
Re: Biologische Grundwissen und die Medien
Zum vorstehenden Beitrag von Emse:
Wir sind hier zum Diskutieren, nicht zum Streiten. Unterschiedliche Meinungen soll und darf es geben. So ist jeder Beitrag willkommen, wenn er nur Substanz hat. Dein Link, Emse, zu dem Zeit-Artikel ist jedenfalls einen längeren Blick wert! Wie weit die Idee des "Waldbadens" bereits entwickelt wurde, war mir nicht klar. Doch meine Bedenken werden nicht ausgeräumt!
„Waldbaden“ soll also zum neuen Trend hochstilisiert werden. Geschäftemacherei Tür und Tor geöffnet. „Lehrgänge“, Waldbadekleidung, Waldbade-Reisen (mal eben für ein WE nach Finnland oder Schweden jetten, Stechmücken, Kriebelmücken, Bremsen inklusive; im Winter: Urlaub in den Blue Mountains W Sydney, Eukalyptusöl reichert die Luft so an, dass die Luft bläulich erscheint, daher der Name, wird ja auch als Heilmittel in Bonbons etc. schon lange genutzt, ein „Phytonzid“; auch Wälder der feuchten Tropen empfehlen sich für den Winter, Impfungen und Malariamittel nicht vergessen; usw.
Ich habe übrigens einen Pflanzen-Biochemiker gefragt: Er meint, dass der Begriff „Phytonzide“ zu Recht in Vergessenheit geraten ist…
Der von Emse verlinkte Zeit-Artikel zeigt, dass das Geschäft schon blüht. Zitate:
> Vor zwölf Jahren eröffnete dann das erste Zentrum für "Waldtherapie", und japanische Universitäten bieten inzwischen eine fachärztliche Spezialisierung in "Waldmedizin" an<
> Im Ostseebad Heringsdorf auf Usedom ist gerade der nach eigenen Angaben "erste europäische Kur- und Heilwald" entstanden. Das 180 Hektar große Gelände gilt als Vorbild für einen "Heilwald" in Bad Doberan bei Rostock und für andere Gemeinden im wald- und wasserreichen Mecklenburg-Vorpommern, die ihr Grün vermarkten wollen.<
> die Landesgartenschau im Teutoburger Wald von Bad Iburg hat Waldbaden in ihr tägliches Veranstaltungsprogramm aufgenommen – dort hat Annette Bernjus gerade zwölf Waldbadekursleiter ausgebildet.<
> Aber kann der Wald mehr als Wellness? Welche medizinischen Effekte des Waldbadens sind seriös belegbar und nicht nur gefühlt vorhanden? Und gibt es bald Waldbesuche auf Rezept?<
Zum sonstigen Inhalt des Wohlleben-Interviews:
Weshalb grenzwertige „Informationen“ wie über den Winter der Honigbienen, wo die sicher richtige Info über den normalen Ablauf der Winterruhe es gewiss auch tun würde?
Schnecken: Weshalb nicht gerade mal differenzieren und „Nacktschnecken“ schreiben?
Ich bin vielleicht überkritisch! Habe mich von Kindheit an viel im Wald, in der „freien Natur“ (auch Trockengebiete, oft dann beruflich) aufgehalten und habe ja im Schlusssatz auch darauf hingewiesen, dass solche Aufenthalte schön und erholsam sind. Das muss nicht unbedingt kommerzialisiert werden!
In dem von mir aufgegriffenen Stern-Interview waren mir halt die drei Themen aufgefallen. Sie stehen exemplarisch dafür, wie heute in den Medien fragwürdige Bio-Inhalte verbreitet werden. Ich werde einige nachliefern. Wohlleben ist nur einer von vielen, die „Natur“ allzu sehr romantisieren und die (oft grausame!) Wirklichkeit verschleiern. Das Buch von Wohlleben habe ich nicht gelesen, kenne nur ein paar Inhalte aus zweiter Hand (Dachte, ich hätte mich hier im AP bereits dazu geäußert; da ist es aber wohl bei der Absicht geblieben ). Danach sollen Bäume kommunizieren, und kleine Bäumchen unterstützen etc..
). Danach sollen Bäume kommunizieren, und kleine Bäumchen unterstützen etc..
Das in der Biologie durchwegs gültige Prinzip kennt er nicht, oder verschweigt es: Konkurrenz, Individual-Egoismus. Darwin hat absolut Recht mit seinem „Kampf ums Überleben“, und u.a. Dawkins („Das egoistische Gen“) haben das auf wissenschaftliche Basis gestellt: „Altruismus ist keine evolutionsstabile Strategie“. Der „Altruismus“ der eusozialen Insekten wurde ja entlarvt als verkappter Egoismus. Meines Wissens gibt es keine Lebensform, die „freiwillig“ Ressourcen an andere Organismen (auch derselben Art) abgibt. - Ich denke, auf dieses Thema werden wir in dem Thread noch näher zu sprechen kommen.
Vorab: Der Mensch ist die einzige Spezies, die sich über die biologischen Grundlagen von Egoismus, Konkurrenz etc. Gedanken machen kann, die Konsequenzen vorhersehen kann, und sich in ihrem Verhalten bewusst darüber hinwegsetzen kann. Man muss das Prinzip nur kennen, und sich darüber hinwegsetzen wollen.
Und nur wenn wir uns von dem Diktat des angeborenen Egoismus freimachen, können wir uns vom Tier abgrenzen, das heißt: Wirklich menschlich werden!
MfG,
Merkur
Wir sind hier zum Diskutieren, nicht zum Streiten. Unterschiedliche Meinungen soll und darf es geben. So ist jeder Beitrag willkommen, wenn er nur Substanz hat. Dein Link, Emse, zu dem Zeit-Artikel ist jedenfalls einen längeren Blick wert! Wie weit die Idee des "Waldbadens" bereits entwickelt wurde, war mir nicht klar. Doch meine Bedenken werden nicht ausgeräumt!

„Waldbaden“ soll also zum neuen Trend hochstilisiert werden. Geschäftemacherei Tür und Tor geöffnet. „Lehrgänge“, Waldbadekleidung, Waldbade-Reisen (mal eben für ein WE nach Finnland oder Schweden jetten, Stechmücken, Kriebelmücken, Bremsen inklusive; im Winter: Urlaub in den Blue Mountains W Sydney, Eukalyptusöl reichert die Luft so an, dass die Luft bläulich erscheint, daher der Name, wird ja auch als Heilmittel in Bonbons etc. schon lange genutzt, ein „Phytonzid“; auch Wälder der feuchten Tropen empfehlen sich für den Winter, Impfungen und Malariamittel nicht vergessen; usw.
Ich habe übrigens einen Pflanzen-Biochemiker gefragt: Er meint, dass der Begriff „Phytonzide“ zu Recht in Vergessenheit geraten ist…
Der von Emse verlinkte Zeit-Artikel zeigt, dass das Geschäft schon blüht. Zitate:
> Vor zwölf Jahren eröffnete dann das erste Zentrum für "Waldtherapie", und japanische Universitäten bieten inzwischen eine fachärztliche Spezialisierung in "Waldmedizin" an<
> Im Ostseebad Heringsdorf auf Usedom ist gerade der nach eigenen Angaben "erste europäische Kur- und Heilwald" entstanden. Das 180 Hektar große Gelände gilt als Vorbild für einen "Heilwald" in Bad Doberan bei Rostock und für andere Gemeinden im wald- und wasserreichen Mecklenburg-Vorpommern, die ihr Grün vermarkten wollen.<
> die Landesgartenschau im Teutoburger Wald von Bad Iburg hat Waldbaden in ihr tägliches Veranstaltungsprogramm aufgenommen – dort hat Annette Bernjus gerade zwölf Waldbadekursleiter ausgebildet.<
> Aber kann der Wald mehr als Wellness? Welche medizinischen Effekte des Waldbadens sind seriös belegbar und nicht nur gefühlt vorhanden? Und gibt es bald Waldbesuche auf Rezept?<
Zum sonstigen Inhalt des Wohlleben-Interviews:
Weshalb grenzwertige „Informationen“ wie über den Winter der Honigbienen, wo die sicher richtige Info über den normalen Ablauf der Winterruhe es gewiss auch tun würde?
Schnecken: Weshalb nicht gerade mal differenzieren und „Nacktschnecken“ schreiben?
Ich bin vielleicht überkritisch! Habe mich von Kindheit an viel im Wald, in der „freien Natur“ (auch Trockengebiete, oft dann beruflich) aufgehalten und habe ja im Schlusssatz auch darauf hingewiesen, dass solche Aufenthalte schön und erholsam sind. Das muss nicht unbedingt kommerzialisiert werden!
In dem von mir aufgegriffenen Stern-Interview waren mir halt die drei Themen aufgefallen. Sie stehen exemplarisch dafür, wie heute in den Medien fragwürdige Bio-Inhalte verbreitet werden. Ich werde einige nachliefern. Wohlleben ist nur einer von vielen, die „Natur“ allzu sehr romantisieren und die (oft grausame!) Wirklichkeit verschleiern. Das Buch von Wohlleben habe ich nicht gelesen, kenne nur ein paar Inhalte aus zweiter Hand (Dachte, ich hätte mich hier im AP bereits dazu geäußert; da ist es aber wohl bei der Absicht geblieben
 ). Danach sollen Bäume kommunizieren, und kleine Bäumchen unterstützen etc..
). Danach sollen Bäume kommunizieren, und kleine Bäumchen unterstützen etc.. Das in der Biologie durchwegs gültige Prinzip kennt er nicht, oder verschweigt es: Konkurrenz, Individual-Egoismus. Darwin hat absolut Recht mit seinem „Kampf ums Überleben“, und u.a. Dawkins („Das egoistische Gen“) haben das auf wissenschaftliche Basis gestellt: „Altruismus ist keine evolutionsstabile Strategie“. Der „Altruismus“ der eusozialen Insekten wurde ja entlarvt als verkappter Egoismus. Meines Wissens gibt es keine Lebensform, die „freiwillig“ Ressourcen an andere Organismen (auch derselben Art) abgibt. - Ich denke, auf dieses Thema werden wir in dem Thread noch näher zu sprechen kommen.
Vorab: Der Mensch ist die einzige Spezies, die sich über die biologischen Grundlagen von Egoismus, Konkurrenz etc. Gedanken machen kann, die Konsequenzen vorhersehen kann, und sich in ihrem Verhalten bewusst darüber hinwegsetzen kann. Man muss das Prinzip nur kennen, und sich darüber hinwegsetzen wollen.
Und nur wenn wir uns von dem Diktat des angeborenen Egoismus freimachen, können wir uns vom Tier abgrenzen, das heißt: Wirklich menschlich werden!
MfG,
Merkur
- 2
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9942
Re: Biologische Grundwissen und die Medien
Biologieverständnis: Note 5!
Allmählich wird es zum Trauma, welchen Blödsinn man über biologische Fakten in den Medien lesen darf (ich meine ausdrücklich nicht die „social media“, wo der Quatsch systemimmanent ist).
1.) Darmstädter Echo vom Mo 22. Juni 2020, S. 19: RATGEBER.
Zu den „Glühwürmchen“ oder Leuchtkäfern, die man selten genug zu sehen bekommt, die aber im Moment wieder fliegen sollten:
„Taumelnd vor Glück schweben die männlichen Käfer über den Boden...“ - Was sollen sie denn sonst tun auf der Suche nach den Lichtsignalen der Weibchen am Boden? Und ob sie dabei „Glück“ empfinden?
„Für die Glühwürmchen geht es dabei nicht nur um Sex, sondern um Fortpflanzung. Ist die Hochzeitsnacht vorbei, müssen die Männchen sterben, ...“ - Gibt es in der Natur einen anderen Grund für Sex, außer
„im Dienste der Fortpflanzung“?
Saudämliche Vermenschlichung!
2.) Stern Nr. 26, 18.6.2020
„Im Reich der Pelzträger“, S. 86-97. Es geht um Hummeln.
S. 94 glänzt mit haarsträubenden Vergleichen zwischen Hummel und Homo sapiens.
Auch hier haben die Verfasser eine krude Vorstellung von biologischen Tatsachen.
Die Hauptnahrungsquelle für die Hummel-Larven sind Pollen und Blütennektar. Mit Fett künstlich angereicherter Pollen wird weniger gerne gefressen als naturbelassener. „Gefressen“ steht da, aber der Pollen wird ja von Arbeiterinnen in den bekannten Pollenhöschen an den Hinterbeinen eingetragen, und dann an die Brut verfüttert. Wer „frisst“ nun den fettigen Pollen?
„Fett, … mindert die Fortpflanzungsfähigkeit der Hummeln“. Wessen Fortpflanzungsfähigkeit? Die der Königin im Nest? Oder die von Arbeiterinnen, die am Ende des Brutzyklus zum Teil Eier legen und männlichen Nachwuchs erzeugen? Oder werden weniger Jungköniginnen aufgezogen? - Die Hummeln achten also „entsprechend konsequent auf ihre Ernährung“.
Dann kommt der ganz dicke Hammer: Der Vergleich von Hummeln mit menschlichen Versuchspersonen, die sich eher von industriell verarbeiteten Lebensmitteln ernährten, und pro Ejakulat 45 Millionen weniger Spermien aufwiesen als jene, die auf gesunde Nahrung achteten. „So viel zur geistigen (und sexuellen) Überlegenheit des Menschen über die Hummel.“
- Ob man sexuelle Überlegenheit an der Spermienmenge ablesen kann? Das Hummelmännchen kann sich ja nur einige wenige Male verpaaren, anders als der Homo sapiens. Und die Ernährung der Hummeln wurde von der Selektion über ca. 40 Millionen Jahre der Ko-Evolution mit Blütenpflanzen optimiert, ohne irgendeine „geistige Leistung“ seitens der Hummeln.
Auch beim Menschen kann man davon ausgehen, dass die Nahrungswahl von der Evolution gesteuert wurde, über Hunderttausende von Jahren, in Anpassung an das Angebot und die Verträglichkeit. „Industriell verarbeitete Lebensmittel“ gibt es bestenfalls seit einigen Jahrzehnten, längst nicht ausreichend für eine genetische Anpassung. Problematisch ist eher das Überangebot an fast food, und die Phagostimulanzien, die es attraktiver machen als relativ naturbelassene Nahrung.
Und schließlich: „Denn die Hummel ist dem Menschen seit Tausenden Jahren ein selbstloser Gefährte“. -
Hummeln dürften zig Millionen Jahre länger auf der Erde sein als der Homo sapiens.
Vielleicht bin ich zu kritisch. Aber „steter Tropfen höhlt den Stein“. Ob nicht die stete Berieselung mit fragwürdigen „Informationen“ unsere „geistige Überlegenheit“ doch allmählich reduziert?
MfG,
Merkur
Allmählich wird es zum Trauma, welchen Blödsinn man über biologische Fakten in den Medien lesen darf (ich meine ausdrücklich nicht die „social media“, wo der Quatsch systemimmanent ist).
1.) Darmstädter Echo vom Mo 22. Juni 2020, S. 19: RATGEBER.
Zu den „Glühwürmchen“ oder Leuchtkäfern, die man selten genug zu sehen bekommt, die aber im Moment wieder fliegen sollten:
„Taumelnd vor Glück schweben die männlichen Käfer über den Boden...“ - Was sollen sie denn sonst tun auf der Suche nach den Lichtsignalen der Weibchen am Boden? Und ob sie dabei „Glück“ empfinden?
„Für die Glühwürmchen geht es dabei nicht nur um Sex, sondern um Fortpflanzung. Ist die Hochzeitsnacht vorbei, müssen die Männchen sterben, ...“ - Gibt es in der Natur einen anderen Grund für Sex, außer
„im Dienste der Fortpflanzung“?
Saudämliche Vermenschlichung!

2.) Stern Nr. 26, 18.6.2020
„Im Reich der Pelzträger“, S. 86-97. Es geht um Hummeln.
S. 94 glänzt mit haarsträubenden Vergleichen zwischen Hummel und Homo sapiens.
Auch hier haben die Verfasser eine krude Vorstellung von biologischen Tatsachen.
Die Hauptnahrungsquelle für die Hummel-Larven sind Pollen und Blütennektar. Mit Fett künstlich angereicherter Pollen wird weniger gerne gefressen als naturbelassener. „Gefressen“ steht da, aber der Pollen wird ja von Arbeiterinnen in den bekannten Pollenhöschen an den Hinterbeinen eingetragen, und dann an die Brut verfüttert. Wer „frisst“ nun den fettigen Pollen?
„Fett, … mindert die Fortpflanzungsfähigkeit der Hummeln“. Wessen Fortpflanzungsfähigkeit? Die der Königin im Nest? Oder die von Arbeiterinnen, die am Ende des Brutzyklus zum Teil Eier legen und männlichen Nachwuchs erzeugen? Oder werden weniger Jungköniginnen aufgezogen? - Die Hummeln achten also „entsprechend konsequent auf ihre Ernährung“.
Dann kommt der ganz dicke Hammer: Der Vergleich von Hummeln mit menschlichen Versuchspersonen, die sich eher von industriell verarbeiteten Lebensmitteln ernährten, und pro Ejakulat 45 Millionen weniger Spermien aufwiesen als jene, die auf gesunde Nahrung achteten. „So viel zur geistigen (und sexuellen) Überlegenheit des Menschen über die Hummel.“
- Ob man sexuelle Überlegenheit an der Spermienmenge ablesen kann? Das Hummelmännchen kann sich ja nur einige wenige Male verpaaren, anders als der Homo sapiens. Und die Ernährung der Hummeln wurde von der Selektion über ca. 40 Millionen Jahre der Ko-Evolution mit Blütenpflanzen optimiert, ohne irgendeine „geistige Leistung“ seitens der Hummeln.
Auch beim Menschen kann man davon ausgehen, dass die Nahrungswahl von der Evolution gesteuert wurde, über Hunderttausende von Jahren, in Anpassung an das Angebot und die Verträglichkeit. „Industriell verarbeitete Lebensmittel“ gibt es bestenfalls seit einigen Jahrzehnten, längst nicht ausreichend für eine genetische Anpassung. Problematisch ist eher das Überangebot an fast food, und die Phagostimulanzien, die es attraktiver machen als relativ naturbelassene Nahrung.
Und schließlich: „Denn die Hummel ist dem Menschen seit Tausenden Jahren ein selbstloser Gefährte“. -
Hummeln dürften zig Millionen Jahre länger auf der Erde sein als der Homo sapiens.
Vielleicht bin ich zu kritisch. Aber „steter Tropfen höhlt den Stein“. Ob nicht die stete Berieselung mit fragwürdigen „Informationen“ unsere „geistige Überlegenheit“ doch allmählich reduziert?

MfG,
Merkur
- 4
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9942
Re: Biologische Grundwissen und die Medien
Reproduktionserfolg von Ameisenköniginnen, Reproduktionszahl "R", Generationen und Generationswechsel
Hier geht's mal wieder hauptsächlich um die sozialen Medien.
Die Frage danach, wie vielen der schwärmenden Gynen eines Volkes bzw. einer Population die Koloniegründung gelingt, und wie viele letztlich zu Königinnen großer Völker werden, wird in den Ameisenforen immer wieder aufgeworfen. Zahlen werden „in den Raum geworfen“, aus dem Ärmel geschüttelt, doch niemand kann es genau beziffern.
Ein zeitnahes Beispiel:
Wenn von jedem sich fortpflanzenden Individuum ein Nachkomme sich wiederum fortpflanzt, reicht das aus um die Populationsgröße konstant, gleich groß, zu halten!
Das heißt konkret: So lange jedes Ameisenvolk (monogyn, damit‘s übersichtlich bleibt) bis zum Ende seines oft viele Jahre dauernden Lebens eine einzige „erfolgreiche“ Königin (und ein erfolgreiches Männchen) erzeugt hat, ändert sich nichts an der Häufigkeit der Art in ihrem jeweiligen Verbreitungsgebiet! Sämtliche weiteren Geschlechtstiere dürfen früher oder später Räubern, Parasiten und anderen Gegenspielern zum Opfer fallen (wozu auch die in der Ameisenhaltung verbrauchten Gynen und Völker gehören, da sie der Freilandpopulation i.d.R. nicht mehr zur Verfügung stehen).
Selbstverständlich ist diese „1“ ein statistischer, ein Durchschnittswert: Aus manchen Völkern werden mehrere, oder sogar viele Völker gegründet; entsprechend viele andere Völker bleiben ganz ohne reproduzierende Nachkommen. Das kann sich auch von Generation zu Generation ändern, wie man das z. B. von vielen Schadinsekten mit einjähriger oder noch kürzerer Generationenfolge kennt: In manchen Jahren sind solche Arten selten, in anderen Jahren vermehren sie sich explosionsartig: Man spricht von einer Schädlings-Gradation. Dann vermehren sich ihre Gegenspieler und drücken den Wert „1“ weit unter Null. Ein überlebender Restbestand kann sich unter günstigen Umständen rasch wieder zu einer Massenvermehrung aufschaukeln.
Nicht von ungefähr taucht dieser Wert „1“ im Zusammenhang mit unserer Corona-Pandemie auf!
Unter dem "R-Wert" wird die "Reproduktionszahl R" verstanden (auch, und eigentlich besser, „Reinfektionszahl“). Sie beschreibt, wie viele Menschen eine infizierte Person im Mittel ansteckt. Ist der Wert ein wenig über 1, wächst die Anzahl der Infizierten, und auf längere Sicht nimmt ihre Zahl exponentiell zu. Bleibt der Wert unter 1, geht die Zahl der Infizierten zurück, und wenn das anhält, nähert man sich allmählich („asymptotisch“) dem Wert 0: dann wäre das Virus ausgestorben! (Leider wird man noch lange zu kämpfen haben, bis der R-Wert wenigstens nahe an die Null herankommt; ganz aussterben wird das Virus nicht).
Zur Verdeutlichung: Ein „Reproduktionswert“ von 1,0 bei Homo sapiens würde bedeuten, dass statistisch jedes Paar in seinem Leben genau zwei Kinder haben müsste, die ihrerseits wieder zusammen mit Partner je zwei Kinder produzieren müssten. Da unter natürliche Bedingungen nicht alle Nachkommen bis zur Geschlechtsreife gelangen, vorzeitig Erkrankungen zum Opfer fallen, intraspezifischen Auseinandersetzungen (Krieg, Verbrechen), Seuchen, Unfällen, Naturkatastrophen, oder (in früheren Zeiten häufiger) räuberischen Tieren, muss die durchschnittliche Zahl der Geburten und der erfolgreich aufgezogenen Kinder über zwei pro Paar liegen, um die Populationsgröße gleich zu halten.
Frau Homo sapiens kann von Natur aus auch 10 und mehr Kinder gebären (das gab es in den Generationen unserer Eltern, Großeltern usw. durchaus!).
Nun ist der Mensch das einzige Lebewesen, das bewusst versucht, jedes geborene Kind am Leben zu erhalten (Abtreibungs-Verbote wollen bereits ab der Befruchtung das Überleben sichern). Dank zunehmend besserer Nahrungsversorgung und vor allem medizinischer Fortschritte gelingt das immer besser, mit der Folge, dass der R-Wert zunimmt, und damit die Gesamt-Bevölkerung der Erde (in meiner Eltern-Generation gab es ca. 2 Milliarden Menschen auf der Erde; jetzt nähern wir uns den 8 Milliarden). Die bewusste Beschränkung auf im Mittel weniger als zwei Kinder pro Paar ist eine Erscheinung v. a. in hoch entwickelten Ländern, wo z. B. wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle spielen).
Im Zusammenhang dieser Erörterung ist wiederholt von Generationen die Rede. Auch dazu will ich ein paar Bemerkungen anbringen, da man auch zu diesem Thema oft auf unklare Vorstellungen stößt.
So liest man immer wieder von Ameisenvölkern, die im Lauf des Sommers zwei oder drei Generationen von Arbeiterinnen aufziehen. Das ist falsch:
Sämtliche Arbeiterinnen und Geschlechtstiere, die in einem monogynen Volk, also von der einen, einmal begatteten Königin, hervorgebracht werden, gehören einer einzigen Generation an, ihrer „Tochtergeneration“ (wiss.: Filialgeneration, F1, von lat. filia, filius = Tochter, Sohn; vgl. „Filialen“ von Unternehmen). Erst deren Nachkommen , die F2, sind eine neue, die Enkelgeneration!
Zur Verdeutlichung: Beim Menschen spricht man von der Elterngeneration, der Generation der Kinder, der Enkel usw.; ein erstes Kind und ein zehn Jahre später geborenes zweites Kind gehören nicht zwei Generationen an, sondern beide der F1. Und eine Lasius niger-Königin erzeugt Pygmäen als erste Arbeiterinnen, später normale Arbeiterinnen, und das über Jahre hinweg: Sie alle gehören der F1, der Tochtergeneration an, ebenso wie alle Gynen und Männchen, die sie über ihre Lebenszeit hinweg erzeugt! Erst wenn von dieser Königin produzierte junge Gynen ihrerseits nach der Paarung wieder Nachkommen erzeugen, stellen diese die nächste Generation, die F2 dar.
Für die sämtlichen Nachkommen einer Königin, die ja oft in „Schüben“ aufwachsen, gilt, dass sie derselben Generation angehören (im Englischen spricht man von brood batch, dt. „Schub“ oder „Schwung“). - Nur wenn Arbeiterinnen Eier ablegen, aus denen Männchen entstehen, gehören diese zur F2, sind also bereits eine Enkelgeneration der Königin).
(Wenn man sich vorstellt, dass junge Gynen (F1) aus einer der ersten Bruten einer Königin nach drei Jahren bereits F2-Gynen erzeugen, und diese nach weiteren drei Jahren F3-Gynen, können diese Urenkelinnen unter Umständen von Männchen der F1-Generation begattet werden, also Söhnen der ursprünglichen Königin. Dann entstehen ganz merkwürdige Verwandtschaftsverhältnisse: Ein Sohn der Stammkönigin verpaart mit einer ihrer Urenkelinnen, usw. ) - Die Stammkönigin kann ja über 15 oder 20 Jahre Jungköniginnen und Männchen als Nachwuchs haben!)
) - Die Stammkönigin kann ja über 15 oder 20 Jahre Jungköniginnen und Männchen als Nachwuchs haben!)
Generationswechsel ist in diesem Zusammenhang ein weiterer Begriff, der gerne mit Generationenwechsel verwechselt wird. Man liest öfter, dass z. B. in einer Firma ein „Generationswechsel“ erfolgt, wenn der Vater dem Sohn die Leitung des Unternehmens übergibt. Was ist der Fehler?
Die Inhaber wechseln gewiss nicht ihren Fortpflanzungsmodus. Es ist ein Wechsel der Generationen, von der Eltern- zur Tochtergeneration, also ein „Generationenwechsel“.
Generationswechsel hingegen ist ein Wechsel in der Form der Erzeugung der Nachkommen („generieren“ = erzeugen). Bei Tieren (und Pflanzen) kann es regelmäßige Wechsel zwischen zweigeschlechtlicher Erzeugung von Nachkommen (bisexuelle Fortpflanzung) und eingeschlechtlicher (parthenogenetischer) Fortpflanzung geben. Solche Generationswechsel sind z. B. bei vielen Blattlausarten bekannt: Eine aus Männchen und Weibchen bestehende Generation produziert aus befruchteten Eiern ausschließlich Weibchen. Diese wachsen heran und gebären ausschließlich weitere weibliche Jungtiere (es werden keine Eier abgelegt; die Jungtiere entwickeln sich aus unbefruchteten Eizellen im Körper der Mutter und werden als lebende Junglarven geboren). Weitere solche eingeschlechtliche (weibliche) Generationen schließen sich an (was oft zu einer raschen Massenvermehrung von Blattläusen führt), bis z. B. im Herbst, ebenfalls parthenogenetisch erzeugt, eine Generation von Weibchen UND Männchen entsteht. Diese verpaaren sich, und die Weibchen legen befruchtete Eier, die (in diesem Beispiel) dann den Winter überstehen. Im Frühjahr schlüpfen aus den Eiern wiederum nur Weibchen, die sich parthenogenetisch fortpflanzen, usw..
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es sich bei den beiden Möglichkeiten, zweigeschlechtliche und eingeschlechtliche Fortpflanzung, um die Entstehung von Nachkommen aus Keimzellen handelt, also Eizellen und ggf. Spermazellen.
Eine dritte Möglichkeit der Fortpflanzung ist die ungeschlechtliche, bei der keine Keimzellen beteiligt sind: Es sind Formen der „Knospung“ (z. B. bei Hydrozoa, Polypen, oder Teilung eines Körpers bei manchen Polychaeten etc.). Dabei sind nur normale (somatische) Körperzellen beteiligt. Bei Pflanzen kommt das öfter vor, was man z. B. bei der Ablegerbildung nutzt, oder bei der Vermehrung von Kartoffeln über Speicherknollen.
Diese Ausführungen und Zusammenhänge sind mit grundlegenden Kenntnissen der Biologie im Prinzip leicht nachvollziehbar und logisch. Oft habe ich jedoch den Eindruck, dass selbst professionelle Biologen sich dieser Tatsachen nicht immer bewusst sind. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, jemals ausdrücklich gehört oder gelesen zu haben, dass eine Population konstant bleibt, wenn die Reproduktionszahl im Mittel über Generationen „1,0“ beträgt.
Das oft zitierte „biologische Gleichgewicht“ ist ein dynamisches, ein „Fließgleichgewicht“: Es besteht, so lange sich Zuwachs und Verlust bei allen beteiligten Arten die Waage halten. Scheinbar geringfügige Änderungen, etwa in der Zahl der „erfolgreichen“ Nachkommen der Species x (Reproduktionszahl steigt z. B. auf 1,02) führt zu Änderungen im „R“ bei deren Räubern y (deren „R“ steigt ebenfalls), bis das „R“ von x dank Räuberdruck wieder zurückgeht, was das „R“ der Räuber durch Ressourcenverknappung wieder verringert, usw.
Ein Beispiel, über das man nachdenken kann: Eine Eiche produziert jährlich einige Tausend Eicheln, und das über evtl. 300 Jahre. Die Zahl der Eichen in einem stabilen Wald bleibt dennoch über Jahrhunderte die gleiche: Wenige Alteichen sterben, und nur deren Platz wird durch junge ersetzt. Von den Millionen potenziellen Nachkommen eines Baumes hat gerade mal einer die Chance, zu einem reproduzierenden Baum heranzuwachsen, „R“ = 1,0 ! Den Rest fressen die Wildschweine, Eichelhäher, oder die Rüsselkäferlarven in den Eicheln, oder die Sämlinge verkümmern im Schatten der Altbäume.
- Ein langer Text, aber kürzer lassen sich solche Überlegungen nicht verständlich darstellen, und ohne bekannte Beispiele bleiben sie unanschaulich.
MfG,
Merkur
Hier geht's mal wieder hauptsächlich um die sozialen Medien.

Die Frage danach, wie vielen der schwärmenden Gynen eines Volkes bzw. einer Population die Koloniegründung gelingt, und wie viele letztlich zu Königinnen großer Völker werden, wird in den Ameisenforen immer wieder aufgeworfen. Zahlen werden „in den Raum geworfen“, aus dem Ärmel geschüttelt, doch niemand kann es genau beziffern.
Ein zeitnahes Beispiel:
Dabei ist alles ganz einfach:„Ich sag mal, Lasius niger in der Haltung Gründen zu lassen, geht's ihnen deutlich besser als in der Natur. Ich möchte nicht wissen, von wievielen Tausenden die Gründung in der Natur schaffen, und wieviele nicht.“
Wenn von jedem sich fortpflanzenden Individuum ein Nachkomme sich wiederum fortpflanzt, reicht das aus um die Populationsgröße konstant, gleich groß, zu halten!
Das heißt konkret: So lange jedes Ameisenvolk (monogyn, damit‘s übersichtlich bleibt) bis zum Ende seines oft viele Jahre dauernden Lebens eine einzige „erfolgreiche“ Königin (und ein erfolgreiches Männchen) erzeugt hat, ändert sich nichts an der Häufigkeit der Art in ihrem jeweiligen Verbreitungsgebiet! Sämtliche weiteren Geschlechtstiere dürfen früher oder später Räubern, Parasiten und anderen Gegenspielern zum Opfer fallen (wozu auch die in der Ameisenhaltung verbrauchten Gynen und Völker gehören, da sie der Freilandpopulation i.d.R. nicht mehr zur Verfügung stehen).
Selbstverständlich ist diese „1“ ein statistischer, ein Durchschnittswert: Aus manchen Völkern werden mehrere, oder sogar viele Völker gegründet; entsprechend viele andere Völker bleiben ganz ohne reproduzierende Nachkommen. Das kann sich auch von Generation zu Generation ändern, wie man das z. B. von vielen Schadinsekten mit einjähriger oder noch kürzerer Generationenfolge kennt: In manchen Jahren sind solche Arten selten, in anderen Jahren vermehren sie sich explosionsartig: Man spricht von einer Schädlings-Gradation. Dann vermehren sich ihre Gegenspieler und drücken den Wert „1“ weit unter Null. Ein überlebender Restbestand kann sich unter günstigen Umständen rasch wieder zu einer Massenvermehrung aufschaukeln.
Nicht von ungefähr taucht dieser Wert „1“ im Zusammenhang mit unserer Corona-Pandemie auf!
Unter dem "R-Wert" wird die "Reproduktionszahl R" verstanden (auch, und eigentlich besser, „Reinfektionszahl“). Sie beschreibt, wie viele Menschen eine infizierte Person im Mittel ansteckt. Ist der Wert ein wenig über 1, wächst die Anzahl der Infizierten, und auf längere Sicht nimmt ihre Zahl exponentiell zu. Bleibt der Wert unter 1, geht die Zahl der Infizierten zurück, und wenn das anhält, nähert man sich allmählich („asymptotisch“) dem Wert 0: dann wäre das Virus ausgestorben! (Leider wird man noch lange zu kämpfen haben, bis der R-Wert wenigstens nahe an die Null herankommt; ganz aussterben wird das Virus nicht).
Zur Verdeutlichung: Ein „Reproduktionswert“ von 1,0 bei Homo sapiens würde bedeuten, dass statistisch jedes Paar in seinem Leben genau zwei Kinder haben müsste, die ihrerseits wieder zusammen mit Partner je zwei Kinder produzieren müssten. Da unter natürliche Bedingungen nicht alle Nachkommen bis zur Geschlechtsreife gelangen, vorzeitig Erkrankungen zum Opfer fallen, intraspezifischen Auseinandersetzungen (Krieg, Verbrechen), Seuchen, Unfällen, Naturkatastrophen, oder (in früheren Zeiten häufiger) räuberischen Tieren, muss die durchschnittliche Zahl der Geburten und der erfolgreich aufgezogenen Kinder über zwei pro Paar liegen, um die Populationsgröße gleich zu halten.
Frau Homo sapiens kann von Natur aus auch 10 und mehr Kinder gebären (das gab es in den Generationen unserer Eltern, Großeltern usw. durchaus!).
Nun ist der Mensch das einzige Lebewesen, das bewusst versucht, jedes geborene Kind am Leben zu erhalten (Abtreibungs-Verbote wollen bereits ab der Befruchtung das Überleben sichern). Dank zunehmend besserer Nahrungsversorgung und vor allem medizinischer Fortschritte gelingt das immer besser, mit der Folge, dass der R-Wert zunimmt, und damit die Gesamt-Bevölkerung der Erde (in meiner Eltern-Generation gab es ca. 2 Milliarden Menschen auf der Erde; jetzt nähern wir uns den 8 Milliarden). Die bewusste Beschränkung auf im Mittel weniger als zwei Kinder pro Paar ist eine Erscheinung v. a. in hoch entwickelten Ländern, wo z. B. wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle spielen).
Im Zusammenhang dieser Erörterung ist wiederholt von Generationen die Rede. Auch dazu will ich ein paar Bemerkungen anbringen, da man auch zu diesem Thema oft auf unklare Vorstellungen stößt.
So liest man immer wieder von Ameisenvölkern, die im Lauf des Sommers zwei oder drei Generationen von Arbeiterinnen aufziehen. Das ist falsch:
Sämtliche Arbeiterinnen und Geschlechtstiere, die in einem monogynen Volk, also von der einen, einmal begatteten Königin, hervorgebracht werden, gehören einer einzigen Generation an, ihrer „Tochtergeneration“ (wiss.: Filialgeneration, F1, von lat. filia, filius = Tochter, Sohn; vgl. „Filialen“ von Unternehmen). Erst deren Nachkommen , die F2, sind eine neue, die Enkelgeneration!
Zur Verdeutlichung: Beim Menschen spricht man von der Elterngeneration, der Generation der Kinder, der Enkel usw.; ein erstes Kind und ein zehn Jahre später geborenes zweites Kind gehören nicht zwei Generationen an, sondern beide der F1. Und eine Lasius niger-Königin erzeugt Pygmäen als erste Arbeiterinnen, später normale Arbeiterinnen, und das über Jahre hinweg: Sie alle gehören der F1, der Tochtergeneration an, ebenso wie alle Gynen und Männchen, die sie über ihre Lebenszeit hinweg erzeugt! Erst wenn von dieser Königin produzierte junge Gynen ihrerseits nach der Paarung wieder Nachkommen erzeugen, stellen diese die nächste Generation, die F2 dar.
Für die sämtlichen Nachkommen einer Königin, die ja oft in „Schüben“ aufwachsen, gilt, dass sie derselben Generation angehören (im Englischen spricht man von brood batch, dt. „Schub“ oder „Schwung“). - Nur wenn Arbeiterinnen Eier ablegen, aus denen Männchen entstehen, gehören diese zur F2, sind also bereits eine Enkelgeneration der Königin).
(Wenn man sich vorstellt, dass junge Gynen (F1) aus einer der ersten Bruten einer Königin nach drei Jahren bereits F2-Gynen erzeugen, und diese nach weiteren drei Jahren F3-Gynen, können diese Urenkelinnen unter Umständen von Männchen der F1-Generation begattet werden, also Söhnen der ursprünglichen Königin. Dann entstehen ganz merkwürdige Verwandtschaftsverhältnisse: Ein Sohn der Stammkönigin verpaart mit einer ihrer Urenkelinnen, usw.
 ) - Die Stammkönigin kann ja über 15 oder 20 Jahre Jungköniginnen und Männchen als Nachwuchs haben!)
) - Die Stammkönigin kann ja über 15 oder 20 Jahre Jungköniginnen und Männchen als Nachwuchs haben!)Generationswechsel ist in diesem Zusammenhang ein weiterer Begriff, der gerne mit Generationenwechsel verwechselt wird. Man liest öfter, dass z. B. in einer Firma ein „Generationswechsel“ erfolgt, wenn der Vater dem Sohn die Leitung des Unternehmens übergibt. Was ist der Fehler?
Die Inhaber wechseln gewiss nicht ihren Fortpflanzungsmodus. Es ist ein Wechsel der Generationen, von der Eltern- zur Tochtergeneration, also ein „Generationenwechsel“.
Generationswechsel hingegen ist ein Wechsel in der Form der Erzeugung der Nachkommen („generieren“ = erzeugen). Bei Tieren (und Pflanzen) kann es regelmäßige Wechsel zwischen zweigeschlechtlicher Erzeugung von Nachkommen (bisexuelle Fortpflanzung) und eingeschlechtlicher (parthenogenetischer) Fortpflanzung geben. Solche Generationswechsel sind z. B. bei vielen Blattlausarten bekannt: Eine aus Männchen und Weibchen bestehende Generation produziert aus befruchteten Eiern ausschließlich Weibchen. Diese wachsen heran und gebären ausschließlich weitere weibliche Jungtiere (es werden keine Eier abgelegt; die Jungtiere entwickeln sich aus unbefruchteten Eizellen im Körper der Mutter und werden als lebende Junglarven geboren). Weitere solche eingeschlechtliche (weibliche) Generationen schließen sich an (was oft zu einer raschen Massenvermehrung von Blattläusen führt), bis z. B. im Herbst, ebenfalls parthenogenetisch erzeugt, eine Generation von Weibchen UND Männchen entsteht. Diese verpaaren sich, und die Weibchen legen befruchtete Eier, die (in diesem Beispiel) dann den Winter überstehen. Im Frühjahr schlüpfen aus den Eiern wiederum nur Weibchen, die sich parthenogenetisch fortpflanzen, usw..
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es sich bei den beiden Möglichkeiten, zweigeschlechtliche und eingeschlechtliche Fortpflanzung, um die Entstehung von Nachkommen aus Keimzellen handelt, also Eizellen und ggf. Spermazellen.
Eine dritte Möglichkeit der Fortpflanzung ist die ungeschlechtliche, bei der keine Keimzellen beteiligt sind: Es sind Formen der „Knospung“ (z. B. bei Hydrozoa, Polypen, oder Teilung eines Körpers bei manchen Polychaeten etc.). Dabei sind nur normale (somatische) Körperzellen beteiligt. Bei Pflanzen kommt das öfter vor, was man z. B. bei der Ablegerbildung nutzt, oder bei der Vermehrung von Kartoffeln über Speicherknollen.
Diese Ausführungen und Zusammenhänge sind mit grundlegenden Kenntnissen der Biologie im Prinzip leicht nachvollziehbar und logisch. Oft habe ich jedoch den Eindruck, dass selbst professionelle Biologen sich dieser Tatsachen nicht immer bewusst sind. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, jemals ausdrücklich gehört oder gelesen zu haben, dass eine Population konstant bleibt, wenn die Reproduktionszahl im Mittel über Generationen „1,0“ beträgt.
Das oft zitierte „biologische Gleichgewicht“ ist ein dynamisches, ein „Fließgleichgewicht“: Es besteht, so lange sich Zuwachs und Verlust bei allen beteiligten Arten die Waage halten. Scheinbar geringfügige Änderungen, etwa in der Zahl der „erfolgreichen“ Nachkommen der Species x (Reproduktionszahl steigt z. B. auf 1,02) führt zu Änderungen im „R“ bei deren Räubern y (deren „R“ steigt ebenfalls), bis das „R“ von x dank Räuberdruck wieder zurückgeht, was das „R“ der Räuber durch Ressourcenverknappung wieder verringert, usw.
Ein Beispiel, über das man nachdenken kann: Eine Eiche produziert jährlich einige Tausend Eicheln, und das über evtl. 300 Jahre. Die Zahl der Eichen in einem stabilen Wald bleibt dennoch über Jahrhunderte die gleiche: Wenige Alteichen sterben, und nur deren Platz wird durch junge ersetzt. Von den Millionen potenziellen Nachkommen eines Baumes hat gerade mal einer die Chance, zu einem reproduzierenden Baum heranzuwachsen, „R“ = 1,0 ! Den Rest fressen die Wildschweine, Eichelhäher, oder die Rüsselkäferlarven in den Eicheln, oder die Sämlinge verkümmern im Schatten der Altbäume.
- Ein langer Text, aber kürzer lassen sich solche Überlegungen nicht verständlich darstellen, und ohne bekannte Beispiele bleiben sie unanschaulich.

MfG,
Merkur
- 5
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9942
Re: Biologische Grundwissen und die Medien
Zeitlicher Verlauf der durchschnittlichen Erd(-oberflächen-)temperatur seit 20.000 v. Chr.
Es passt hier ganz gut rein, geht es doch um Grundwissen, das in diesem Beitrag vermittelt wird, nett illustriert, und gut geeignet für Leute, die sich solche zeitliche Dimensionen schwer vorstellen können.
https://xkcd.com/1732/
Stellt Euch auf längeres Scrollen ein. Für die Zeit bis zum Auftauchen des „Anatomisch modernen Menschen“ vor ca. 200.000 Jahren müsste man noch ca 10 mal weiter runter scrollen.
Und Ameisen entstanden vor ca. 140 Mio Jahren....
MfG,
Merkur
Es passt hier ganz gut rein, geht es doch um Grundwissen, das in diesem Beitrag vermittelt wird, nett illustriert, und gut geeignet für Leute, die sich solche zeitliche Dimensionen schwer vorstellen können.

https://xkcd.com/1732/
Stellt Euch auf längeres Scrollen ein. Für die Zeit bis zum Auftauchen des „Anatomisch modernen Menschen“ vor ca. 200.000 Jahren müsste man noch ca 10 mal weiter runter scrollen.
Und Ameisen entstanden vor ca. 140 Mio Jahren....
MfG,
Merkur
- 1
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9942
Re: Biologische Grundwissen und die Medien
Wieder einmal: Die Wespenkönigin hat das ewige Leben!
Irgendwie bin ich zufällig auf diese Seite geraten: https://www.myhomebook.de/news/riesen-wespennest
Zwar stammt der Text bereits aus 2019, aber er wird eben noch immer unverändert präsentiert.
Die von mir rot hervorgehobenen Fehler werden seit Jahrzehnten tradiert. Dabei ist es heute so leicht, über den Lebenszyklus von Ameisen, sozialen Bienen und Wespen korrekte Informationen zu finden, z. B. hier in der Wikipedia:
Aber leider viel zu viele Möchtegern-Informierer verbreiten unentwegt allenthalben ihr trauriges Halbwissen. Es gibt zu der eingangs genannten Webseite ein Impressum...
Es gibt zu der eingangs genannten Webseite ein Impressum...
Im Artikel verlinkt ist auch etwas zu finden über das Entfernen von Wespennestern.
MfG,
Merkur
Irgendwie bin ich zufällig auf diese Seite geraten: https://www.myhomebook.de/news/riesen-wespennest
Zwar stammt der Text bereits aus 2019, aber er wird eben noch immer unverändert präsentiert.
Wie entstehen solche Nester?
Normalerweise sterben Wespenvölker im Herbst, die Königin zieht sich dann zur Überwinterung zurück. Neue Nester entstehen meist erst im April. Bei einem so großen Wespennest handelt es sich aber meist um mehrjährige Kolonien. Aufgrund eines besonders milden Winters und einem reichhaltigen Nahrungsangebot haben diese die kalte Jahreszeit überstanden und sind so schon zu Beginn des Frühlings in großer Zahl vorhanden. Diese „Mega-Nester“ fassen dann bis zu 15.000, in der Spitze angeblich sogar bis zu 250.000 Arbeiter-Drohnen! Zum Vergleich: Normal sind etwa 4.000. Die Entwicklung mehrjähriger Kolonien ist bei dieser Wespenart sowohl im südlichen Teil der USA als auch in Neuseeland schon beobachtet worden.
Die von mir rot hervorgehobenen Fehler werden seit Jahrzehnten tradiert. Dabei ist es heute so leicht, über den Lebenszyklus von Ameisen, sozialen Bienen und Wespen korrekte Informationen zu finden, z. B. hier in der Wikipedia:
Untergang und Neuanfang
Die alte Königin stirbt im Herbst und ihr Wespenstaat löst sich anschließend auf. Bei Kälteeinbruch sterben auch die letzten heimatlos gewordenen Arbeiterinnen des alten Staates. Allein die begatteten Jungköniginnen zeigen eine abweichende Verhaltensweise und suchen sich ein gegen Kälte geschütztes Versteck. In geeignetem Mikroklima wie morschem Holz, in Hohlräumen, unter Rinden oder Moos überstehen sie dann den Winter schlafend in einer Winterstarre, die Diapause genannt wird. Im nächsten Frühjahr gründet die Jungkönigin dann einen neuen Staat, indem sie mit dem Nestbau an geeigneter Stelle beginnt. Alte Nester werden dabei nicht wieder besiedelt.
Aber leider viel zu viele Möchtegern-Informierer verbreiten unentwegt allenthalben ihr trauriges Halbwissen.
 Es gibt zu der eingangs genannten Webseite ein Impressum...
Es gibt zu der eingangs genannten Webseite ein Impressum...Im Artikel verlinkt ist auch etwas zu finden über das Entfernen von Wespennestern.
- Als ich vor vielen Jahren mal aus meinem Gartenhäuschen 38 (!) Gründungsnester von Wespen entfernen musste (die Enkel waren noch klein...), hätte mich das Umsiedeln durch einen Fachmann wohl arm gemacht.Der richtige Zeitpunkt, um ein Wespennest zu entfernen, ist im April oder im Herbst. Im April befindet sich das Nest noch in der „Bauphase“. Im Herbst ist es unbewohnt, da das Wespenvolk tot und die Königin zur Überwinterung umgezogen ist.
MfG,
Merkur
- 1
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9942
Re: Biologische Grundwissen und die Medien
Wo und wie die Medien uns für ungebildet halten…
Ich habe ja schon öfter versucht Klarheit zu schaffen, nach Berichten mit unhaltbaren Angaben, z. B.: hier am 1. Juni 2020, als man schon lustig von der „Stunde Null“ nach Corona gefaselt hat. Diese Stunde hat noch immer nicht geschlagen, jedenfalls bisher…
Kürzlich, am 7. Oktober 2021, hat unsere Tageszeitung (Darmstädter Echo) in einem großen Artikel („Grau in Grau“) über die Flächenversiegelung in Darmstadt berichtet. Darin steht viel Wahres. Aber es wird auch ein verbreiteter Irrtum kritiklos weiter verbreitet, nämlich dass Ackerland große Mengen an CO2 binden könne.
Mein Leserbrief zur Klarstellung wurde tatsächlich am 18. 10. 21 veröffentlicht:
Man sollte wirklich nicht alles für bare Münze nehmen, was uns die Medien vorsetzen, und vor allem mal über den Tag hinaus weiter denken!
Ein weiteres Thema, das zurzeit nicht nur diskutiert, sondern in höchsten Tönen gelobt wird, sind die sogenannten „Tiny forests“.
Auch in Darmstadt wurden und werden solche angelegt. Zur Information: https://permakulturblog.de/tiny-forest/ mit Bildern. Auch die Kommentare sind lesenswert!
Wiederum in unserer Tageszeitung erschienen folgende Äußerungen dazu:
Vielleicht mag mal der eine oder andere User oder Besucher des AP mit etwas Grundwissen in Biologe sich dazu äußern, was die Denkfehler in den Argumenten der Propheten für „Miniwälder“ sind
(oder auch: wo sie uns Bären aufbinden möchten)?
MfG,
Merkur
Ich habe ja schon öfter versucht Klarheit zu schaffen, nach Berichten mit unhaltbaren Angaben, z. B.: hier am 1. Juni 2020, als man schon lustig von der „Stunde Null“ nach Corona gefaselt hat. Diese Stunde hat noch immer nicht geschlagen, jedenfalls bisher…

Kürzlich, am 7. Oktober 2021, hat unsere Tageszeitung (Darmstädter Echo) in einem großen Artikel („Grau in Grau“) über die Flächenversiegelung in Darmstadt berichtet. Darin steht viel Wahres. Aber es wird auch ein verbreiteter Irrtum kritiklos weiter verbreitet, nämlich dass Ackerland große Mengen an CO2 binden könne.
Mein Leserbrief zur Klarstellung wurde tatsächlich am 18. 10. 21 veröffentlicht:
Man sollte wirklich nicht alles für bare Münze nehmen, was uns die Medien vorsetzen, und vor allem mal über den Tag hinaus weiter denken!
Ein weiteres Thema, das zurzeit nicht nur diskutiert, sondern in höchsten Tönen gelobt wird, sind die sogenannten „Tiny forests“.
Auch in Darmstadt wurden und werden solche angelegt. Zur Information: https://permakulturblog.de/tiny-forest/ mit Bildern. Auch die Kommentare sind lesenswert!
Wiederum in unserer Tageszeitung erschienen folgende Äußerungen dazu:
Vielleicht mag mal der eine oder andere User oder Besucher des AP mit etwas Grundwissen in Biologe sich dazu äußern, was die Denkfehler in den Argumenten der Propheten für „Miniwälder“ sind
(oder auch: wo sie uns Bären aufbinden möchten)?
MfG,
Merkur
- 3
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9942
9 Beiträge
• Seite 1 von 1
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
