Camponotus (Tanaemyrmex) fellah
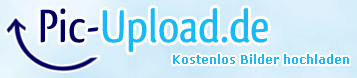
Artbeschreibung - Steckbrief
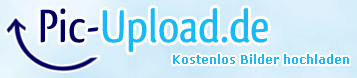
Artbeschreibung - Steckbrief
Taxonomie
Familia: Formicidae (Ameisen)
Subfamilia: Formicinae (Schuppenameisen)
Tribus: Camponotini
Genus: Camponotus Mayr, 1861
Subgenus: Tanaemyrmex Ashmead, 1905
Species: Camponotus fellah Dalla Torre, 1893
Subspecies: -
Allgemeines
Heimat: Israel, Ägypten, Sudan, Eritrea.
Habitat: Steppe, Halbwüste.
Kolonie: monogyn
Koloniegröße: mehrere Tausend
Koloniealter: 26 Jahre in Gefangenschaft
Gründung: claustral
Arbeiterinnen: polymorph
Nestbau: Erdnester
Nahrung: Trophobiose, Zoophagie (Honig und Insekten in der Haltung).
Winterruhe: eventuell Ruhepause
Fortpflanzung: A few massive nuptial flights take place, usually on hot days in early spring, but also at a lower density during summer nights (Kugler, 1989; Levin et al., 2009; and the authors’ unpublished data).
Aussehen/Färbung
Minors-Media: Kopf dunkelbraun bis schwarz, Thorax/Gaster braun, kleine bis mittelgroße Köpfe, extrem schmächtig bis etwas kräftiger gebauter Körper
Majors: Kopf dunkelbraun bis schwarz, Thorax/Gaster dunkelbraun, bulliger Körper, typische Majoren-Kopfform (breite Wangen)
Königinnen: Kopf/Thorax schwarz, Gaster/Beine rot-braun, mittelgroßer Kopf, bulliger Körper
Männchen: Kopf/Thorax schwarz, Gaster/Beine rot-braun, kleiner Kopf, schmächtiger Körper
Einleitung & Vorstellung
Inhaltsverzeichnis (wichtige Ereignisse)
Der Übersicht halber wurde ein Inhaltsverzeichnis angelegt. Der Link führt direkt zum Beitrag der Haltungswoche.
- 03. Haltungswoche: Umzug Nr. 1
05. Haltungswoche: Entwicklungsprobleme (1. Schub)
11. Haltungswoche: Entwicklungsprobleme (2. Schub)
14. Haltungswoche: Umzug Nr.2
20. Haltungswoche: Entwicklungsprobleme überstanden
21. Haltungswoche: Umzug Nr.3
26. Haltungswoche: 1. kleine Majore geschlüpft
28. Haltungswoche: 1. Junggyne geschlüpft
32. Haltungswoche: 1. größere Majore geschlüpft
36. Haltungswoche: Umzug Nr.4
52. Haltungswoche: 1 Jahr Haltung
62. Haltungswoche: Umzug Nr.5
67. Haltungswoche: Anstieg der Sterberate
71. Haltungswoche: Experiment: Markierung von Arbeiterinnen
75. Haltungswoche: Experiment: Legezyklus der Gyne in der Gründungsphase
79. Haltungswoche: 1,5 Jahre Haltung
83. Haltungswoche: Experiment: Markierung von Puppen (Teil 5 - Ende)
86. Haltungswoche: Experiment: Puppen-Entwicklung in Abhängigkeit von der Temperatur
104. Haltungswoche: 2 Jahre Haltung, Experiment: Photophilie
105. Haltungswoche: Umzug Nr. 6
107. Haltungswoche: 1. Männchen geschlüpft
118. Haltungswoche: Experiment: Null-Diät
131. Haltungswoche: Zweieinhalb Jahre Haltung
158. Haltungswoche: 3 Jahre Haltung, Experiment: Massenverhältnisse bei Arbeiterinnen
Größe [~mm]
Pygmäen: 7-9
Minor: 9-11
Media: 11-15
Major: 15-18
Königinnen: 13-19 (~21*)
Männchen: 11-12
*physogastrisch = gedehnter Hinterleib
Entwicklungsdauer [~Tage]
Minor (insg. / Ø): 47-85 (65.5) E - L: 14-30 L - P: 12-32 P - I: 21-25
Media (insg. / Ø): 53-81 (68.5) E - L: 14-30 L - P: 17-29 P - I: 22-25
Major (insg. / Ø): 57-92 (74.5) E - L: 14-30 L - P: 17-29 P - I: 26-33
Legende: E=Ei, L=Larve, P=Puppe, I=Imago, fett=ca.30°C, dünn=RT
Bei der Entwicklungszeit muss mit starken Abweichungen gerechnet werden. Gerade bei den Larven werden häufig nur die Zuerst-Geschlüpften durchgefüttert und später die Nachzügler - daher diese weite Spanne von über zwei Wochen Entwicklung (siehe L - P). Es gilt zu beachten, dass Temperatur und andere Parameter die Entwicklungszeit zusätzlich positiv/negativ beeinflussen können. So weit es möglich war, wurde sich an den Haltungsbedingungen (s.u.) orientiert.
Der erste, dick gedruckte Wert stellt wohl den glaubwürdigsten dar und gibt die schnellste Entwicklungszeit bei etwa 30 °C wieder. Bei Raumtemperatur (ca. 22 °C) muss demnach mit längeren Entwicklungszeiten gerechnet werden. Die Zahlen belaufen sich nur auf die ersten Gründungsmonate, da das genaue Beobachten der Brut mit dem Fortschreiten der Koloniegröße immer schwieriger wird.
Koloniewachstum [Wochen]
Kurze Erläuterung:
Auf die horizontalen Hilfslinien wurde verzichtet, weil die meisten Angaben nur geschätzt werden können, da Eier und Larven mit der Zeit immer schwerer zu zählen sind.
Es geht mehr um das Verhältnis und den Vergleich der Kurven untereinander. Dazu müssen die Werte nicht exakt ablesen werden.
Um die Farben nicht immer vergleichen zu müssen ("Wie? Steht Lila jetzt für Eier oder Larven?") wurden die Farben an den entsprechenden Phänotyp angepasst.
So sollte es ein leichtes sein, z.B. Weiß mit Eiern assoziieren zu können, Gelblich und der gleichen mit Larven bzw. Puppen und Schwarz steht für die Arbeiterinnen von C. fellah.
Alle drei Bruteinheiten zusammen (Eier, Larven, Puppen) wurden durch eine rote Kurve dargestellt.
Die Grafik beschreibt nur das "Vorhanden sein", nicht wie viel Eier die Königin in der Woche gelegt hat!
Sinn und Fragestellungen:
- - Zusammenhang zwischen Legeverhalten der Königin und Größe der Kolonie
- Gegenüberstellung von Bruteinheiten und Arbeiterinnen
- Abhängigkeit zwischen Eier-, Larven- und Puppenanzahl
- Wiederkehrende Zyklen bestimmter Brutstadien
- Abhängigkeit einzelner Stadien von der Jahreszeit
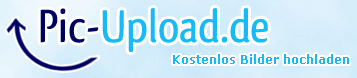
Literatur
Artenliste
- - Hymenoptera Name Server (2007)
- The Ants of Africa - Genus Camponotus subgenus Tanaemyrmex (-)
- Formicidae (Insecta: Hymenoptera) of Saudi Arabia (Part 2) (-)
Artikel und Berichte
- - Beißverhalten und Narbenbildungen bei Camponotus fellah Larven (2011)
Wissenschaftliche Paper
- - Influence of social isolation in the ant Camponotus fellah (Hymenoptera: Formicidae) (1997)
- Social Isolation in Ants: Evidence of its Impact Survivorhip and Behavior in Camponotus fellah (1999)
- Camponotus fellah colony integration: worker individuality necessitates frequent hydrocarbon exchanges (2000)
- OCTOPAMINE REVERSES THE ISOLATION-INDUCED INCREASE IN TROPHALLAXIS IN THE CARPENTER ANT Camponotus FELLAH (2000)
- Comparative dynamics of gestalt odour formation in two ant species Camponotus fellah and Aphaenogaster senilis (Hymenoptera: Formicidae) (2001)
- Social isolation of mature workers affects nestmate recognition in the ant Camponotus fellah (2001)
- Effect of Octopamine Adminstration on the Behavior of the Ant Camponotus fellah (2003)
- Colony insularity through queen control on worker social motivation in ants (2003)
- Odour convergence and tolerance between nestmates through trophallaxis and grooming in the ant Camponotus fellah (Dalla Torre) (2004)
- In-nest environment modulates nestmate recognition in the ant Camponotus fellah (2004)
- Individual olfactory learning in Camponotus ants (2005)
- Nest volatiles as modulators of nestmate recognition in the ant Camponotus fellah (2007)
- Immune response affects ant trophallactic behaviour (2008)
- Blochmannia endosymbionts improve colony growth and immune defence in the ant Camponotus fellah (2009)
- A Camponotus fellah queen sets a record for Israeli ant longevity (2009)
- Differential conditioning and long-term olfactory memory in individual Camponotus fellah ants [url=jeb.biologists.org/content/212/12/1904.full](2009)[/url]
- Calcium imaging in the ant Camponotus fellah reveals a conserved odour-similarity space in insects and mammals (2010)
- Alteration of cuticular hydrocarbon composition affects heterospecific nestmate recognition in the carpenter ant Camponotus fellah (2010)
- Blochmannia endosymbionts and their host, the ant Camponotus fellah: Cuticular hydrocarbons and melanization (2011)
- Long-term olfactory memories are stabilised via protein synthesis in Camponotus fellah ants (2011)
- Social and temporal organization in an ant colony [Dissertation] (2012)
(Links können fehlerhaft sein. Sonst einfach den Titel bei Google eingeben.)
Herkunft
Kontinent: Nordafrika
Land: Ägypten
Gebiet: ?
Klima: Tag/Nacht Klimadiagramme, oder auch diese Quelle (Klick)
"Der wohl größte Teil Ägyptens besteht zu ca. 95 % aus Wüste. Das Klima hier unterliegt den wüstentypischen Temperaturschwankungen: tagsüber sehr heiß und nachts sehr kalt." Quelle
Haltungsbedingungen
Temperatur (Tag): 22-30 °C
Temperatur (Nacht): 18-21 °C
Luftfeuchtigkeit (normal): 30-50 %
Luftfeuchtigkeit (nach gießen): 50-70 %
Winterruhe: Nein, dafür kurze Ruhepause von Dezember bis Januar/Februar (siehe Klimadiagramme)
Kohlenhydrate: Honig pur/verdünnt
Proteine: Heimchen, Mehlwürmer, Fliegen, Spinnen, Raupen, Fisch
Sonstiges: Trinkwasserspender, 20W Nachttischlampe
Auf Grundlage einiger Haltungsberichte wird das Nest dieser Art mit einer 20 Watt Lampe beheizt. Als Sichtschutz dient u.a. matt-schwarze Folie und Pappe, die sich zusätzlich etwas aufheizen. Mit dem Abstand der Lampe zur Scheibe lässt sich die Temperatur kontrollieren. Mit einem Abstand von ca. 3 cm erreicht man gerade so die 30 °C. Als "Sicherheitsabstand" werden auf der Lampe normalerweise 20 cm angegeben.
Ein Vorteil dieser Methode ist, dass man sich eine Heizmatte/-folie sparen kann. Aber eine 3 W Folie wäre wahrscheinlich ausreichend und würde nebenbei noch weniger Energie verbrauchen. Die Lampe brennt je nach Jahreszeit zwischen 6 (Winter) und 12 Stunden (Sommer) am Tag.
Die Luftfeuchtigkeit wird durch zusätzliches Heizen auf unter 50% gehalten. Anfangs sollte das Nest unter Beobachtung bewässert werden, da es zu Entwicklungseinbrüchen bei der Brut kommen kann. Ab 100 Arbeiterinnen ist dies nicht mehr unbedingt nötig, da die Arbeiterinnen ab diesem Zeitpunkt die Brutpflege unter Kontrolle haben. Ein Wassertank ist nicht verpflichtend. Es reicht, wenn das Nest seitlich bewässert wird und sich das Wasser mittels der Kapillarkräfte zwischen Ytong und Plexiglasscheibe ins Nestinnere zieht.
Eine Winterruhe ist für diese Art nicht vorgesehen. Allerdings kann die Königin im Frühjahr eine Legepause von bis zu fünf Wochen einlegen. Mit rund 20°C scheint das Zimmer im Winter zwar eher kühl gehalten, aber trifft genau die klimatischen Gegebenheiten ihrer Herkunft (siehe Herkunft-Klimadiagramm).
Die Haupt Kohlenhydratquelle stellt purer oder verdünnter Honig. Um Abwechslung zu bieten, werden gelegentlich Zuckerwasser und Früchte an sekundären Futterstellen ausgelegt. Mit der Koloniestärke steigt auch die Entfernung der Futterplätze zum Nest (so weit es das 80er Becken zulässt...). Auch die Wurzeln werden dafür eingebunden, damit die Ameisen etwas zu erkunden haben.
Als Proteinquelle dienen in erster Linie überbrühte und dann eingefrorene Heimchen. Kleine Kolonien kann man etwas unter die Arme greifen, wenn man die Futtertiere anschneidet. Im Sommer wird der Speiseplan durch Fliegen, Raupen u.ä. erweitert (auf Milben absuchen!).
Frisches Trinkwasser wird alle ein bis zwei Wochen im Spender angeboten, der zusätzlich mit Watte gesichert ist, damit die Ameisen nicht ertrinken. Die Ameisen nutzen den Spender regelmäßig, daher ist frisches Wasser absolut Pflicht!
Das Becken
Formicariengröße: 80x40x40cm
Material: 6mm Glas, durchsichtiges Silikon (Eigenbau)
Bodenbeschaffenheit: roter Wüstensand mit Lehmanteil und hellem Quarzsand vermischt, Steine, Wurzeln, Tillandsien
Nest: Ytong und mit Gips ausgestrichene Kammern
Ausbruchsschutz: Paraffin auf zweiteiligem Kunststoffrahmen
Sonstiges: keine Bohrungen für eine Erweiterung
Hier hat sich einiges getan, zumindest äußerlich. Das Material ist ja irgendwie doch das gleiche geblieben. Das Becken wurde der neuen Art und ihrer Herkunft angepasst und naturnah gestaltet.
Die Inneneinrichtung ist dieses mal frei aus dem Kopf heraus entstanden. Bilder von diversen Seiten haben nur indirkt einen Einfluss ausgeübt. Um Gewicht zu sparen, wurde ein Styrodurmodell angefertigt, dass nebenbei noch formgebend tätig war. Das Nest wurde dem Beckenstil angepasst und enthält zwei Kammern, davon eine Hauptkammer, die bis zu 20mm tief und 50mm breit ist. Bei entsprechender Koloniegröße wird das Nest ausgetauscht. Als Substrat wurde lehmiger, roter Wüstensand (Höhlensand) verwendet, der etwa 2-3 zu 1 mit weißgelbem Quarzsand vermischt wurde, um das Ganze etwas heller zu gestalten. Durch den Lehmanteil ließ sich der Untergrund gut formen und behielt auch nach dem Austrocknen seine Form. Als Klettermöglichkeit dienten Savannenwurzeln, die das Wüstenbild vervollständigen sollten. Zur Begrünung wurden, wie schon bei C. vagus, Pflanzen (Tillandsien, Sukkulente) ausgewählt, die mit möglichst wenig Wasser und Licht auskommen. Die Neuheit hierbei ist, dass sie sich in einem extra herausnehmbaren Blumentopf befinden und somit autark vom Rest des Beckens sind. Der Kunststoffrahmen wurde aus zwei Teilen gearbeitet, zusammengeklebt und vorübergehend mit Tesafilm auf dem Beckenrand fixiert. Unverdünntes Paraffin dient als Ausbruchsschutz und wird sicherheitshalber einmal im Monat erneuert. Eine Lücke zwischen Rand und Rahmen und die zwei Verbindungsstücke vom Rahmen wurden vorsichtshalber an der Beckenscheibe zusätzlich beschmiert. Da keine Bohrungen vorhanden sind, kann man nur hoffen, dass die Kolonie in den ersten zwei bis drei Jahren es sich nicht allzu breit macht.
Zur Zeit ihrer frühen Gründungsphase nahm die Kolonie noch in einer Miniarena + Mini-Ytong vorlieb.
Die Qual der Wahl (oder: Wieso diese Art?)
Camponotus gehört m.M.n. zu einer der sehenswertesten Gattungen, die die Familie der Ameisen zu bietet hat. Keine großen Verzierungen oder Schnörkeleien, die Ameise als solche ist also noch zu erkennen. Hinzu kommt eine stattliche Größe, die das Beobachten erleichtert und ein gut ausgeprägte Polymorphismus (Media-, Major-Arbeiterinnen). Des Weiteren habe ich darauf geachtet, dass die Art keinen Wehrstachel besitzt, da ich immer den Kontakt zu den Tieren suche. Die Ameisensäure ist nur als beißender Essiggeruch wahrzunehmen, Kontakt mit Schleimhäuten (z.B. Augen) sollte natürlich vermieden werden. Bisher durfte ich die Art als sehr neugierige, kletterfreudige und kampfeslustige Art kennenlernen, die ihren Nesteingang keinen Moment unbewacht lässt. Aber das würde wohl auf so ziemlich jede andere Art zutreffen Das Phänomen "Camponotus" macht den Unterschied.
Bilder/Videos
Die Fotos und Videos werden mit einer Canon IXUS50 geschossen. Manche Bilder werden zusätzlich am Computer bearbeitet, geschnitten oder im Kontrast geändert um gegebenfalls die Qualität zu steigern. C. fellah ist trotz ihrer Größe ein sehr flinke Ameise und lässt sich auch bei optimaler Ausleuchte nicht immer scharf ablichten. In der Regel gehen sehr viele Fotos über den Jordan, bevor man ein brauchbares geknipst hat.
Die Bilder werden nummeriert und zum besseren Verständnis in den Wochenrückblick mit eingearbeitet.
Alle von mir veröffentlichen Daten enthalten das Prädikat © Streaker87, sofern keine andere Quelle angegeben wurde. And for our guests: There is a copyright on each picture and movie.
Schlusswort(e)
Wieder mal ein großes Dankeschön an Herrn Stefan Stenzel (WoA), für die nette Abwicklung und das Telefonat!
Diskussion: >> HIER <<
Gruß,
Streaker87


