Hinweise auf Ameisen in den Medien
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Danke für die Links!
Dabei muss ich unwillkürlich an gewisse "Madenkörbe" für das Angeln denken. Dabei wird ein Draht/Kunststoffgeflecht genutzt, was man zu den Maden in die Dose gibt. Dort krabbeln die Maden dann hinein und wenn man es auswirft, sollen sie wieder heraus krabbeln (was nach meinen Erfahrungen allerdings nicht so recht funktioniert). Offenbar scheint also die Stahlwolle deutlich gröber zu sein als normale Watte.
Dabei muss ich unwillkürlich an gewisse "Madenkörbe" für das Angeln denken. Dabei wird ein Draht/Kunststoffgeflecht genutzt, was man zu den Maden in die Dose gibt. Dort krabbeln die Maden dann hinein und wenn man es auswirft, sollen sie wieder heraus krabbeln (was nach meinen Erfahrungen allerdings nicht so recht funktioniert). Offenbar scheint also die Stahlwolle deutlich gröber zu sein als normale Watte.
- 0
- Colophonius
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Stahlwolle ist mit Sicherheit gröber als Watte. Ich hatte aber auf manchen Fotos schon den Eindruck, es würde schon so Richtung Topfreiberl gehen.
- 0
-

Trailandstreet - Mitglied
- Beiträge: 1174
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 21:02
- Wohnort: Ho'mbua
- Bewertung: 1693
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Die Arbeit von Patrick Krapf erinnert an die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen: Der Ökologie-Doktorand aus Innsbruck ist im gesamten Alpenraum unterwegs, um eine besondere Ameise auszukundschaften.
Ja, Ameisenhandel. Es gebe Ameisenfans, die die Tiere zuhause halten, wie andere Spinnen oder Skorpione. Genügsam sind sie jedenfalls. Krapf hält die Tiere in Plastikdosen, in denen er ihnen mit Watte und Röhrchen kleine Rückzugsorte eingerichtet hat. Er füttert sie mit gefrorenen Fruchtfliegen und Zuckerwasser.
„Es ist schon fein, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Wenn ich mir vorgenommen habe, fünf Nester an einem Standort zu finden und dann wird es schon dunkel, dann könnte ich manchmal verzweifeln. Es gibt aber auch Tage, da habe ich in zehn Minuten das erste Nest gefunden“, erzählt er.
http://www.tt.com/lebensart/freizeit/11 ... meisen.csp
- 2
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
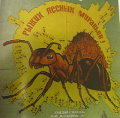
Reber - Moderator
- Beiträge: 1777
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3749
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien/ Tetramorium alpestre
Hierzu ergänzend ein paar Hinweise:
http://ameisenwiki.de/index.php/Tetramorium_alpestre
https://www.ameisenforum.de/tetramorium ... 41802.html
http://www.antwiki.org/wiki/Tetramorium_alpestre
Krapf arbeitet an der Uni Innsbruck, Arbeitsgruppe Schlick-Steiner : https://www.uibk.ac.at/ecology/staff/
https://www.uibk.ac.at/ecology/staff/persons/krapf.html
Steiner F.M., Schlick-Steiner, B.C., Buschinger, A.(2003): First record of unicolonial polygyny in Tetramorium cf. caespitum (Hymenoptera, Formicidae). Insectes soc. 50, 98-99.
Das wurde später die T. alpestre!
MfG,
Merkur
http://ameisenwiki.de/index.php/Tetramorium_alpestre
https://www.ameisenforum.de/tetramorium ... 41802.html
http://www.antwiki.org/wiki/Tetramorium_alpestre
Krapf arbeitet an der Uni Innsbruck, Arbeitsgruppe Schlick-Steiner : https://www.uibk.ac.at/ecology/staff/
https://www.uibk.ac.at/ecology/staff/persons/krapf.html
Steiner F.M., Schlick-Steiner, B.C., Buschinger, A.(2003): First record of unicolonial polygyny in Tetramorium cf. caespitum (Hymenoptera, Formicidae). Insectes soc. 50, 98-99.
Das wurde später die T. alpestre!

MfG,
Merkur
- 1
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9944
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Liebe Ameisenfreunde,
Hier ein Artikel von dem ich nicht weiß ob ihr den schon längst gelesen habt
Kälte treibt Ameisen zur Flucht in die Baumkronen
14.09.2016 Der Standart (Österreich)
http://derstandard.at/2000044355564/Kae ... Baumkronen
Beste Grüße
hormigas
Hier ein Artikel von dem ich nicht weiß ob ihr den schon längst gelesen habt

Kälte treibt Ameisen zur Flucht in die Baumkronen
14.09.2016 Der Standart (Österreich)
http://derstandard.at/2000044355564/Kae ... Baumkronen
Beste Grüße
hormigas
- 5
- hormigas
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Hier ist die Pressemitteilung der Autoren:
http://www.senckenberg.de/root/index.ph ... =2&id=4160
Die Originalarbeit:
Seifert, B., Fiedler, P. and Schultz, R. (2016), Escape to the high canopy – thermal deficiency causes niche expansion in a forest-floor ant. Insect Science. doi: 10.1111/1744-7917.12351
Die Autoren hatten erhebliche Probleme, ihren Beitrag in einer passenden Zeitschrift unterzubringen: Etliche Gutachter „konnten sich einfach nicht vorstellen“, dass so etwas möglich ist, und haben die Annahme abgelehnt. Auch das gibt es in der Forschung.
Mir wollte ein Gutachter mit derselben Begründung mal nicht glauben, dass die kleinen Gastameisen (Formicoxenus nitidulus) die großen Waldameisen (Formica rufa - Gruppe) direkt um Futter anbetteln können. Dabei hatte ich 1966 in der Schweiz persönlich mitgewirkt, dieses Verhalten in einem Fernsehfilm zeigen zu können. Immerhin „durfte“ ich das dann doch in meinem Buchbeitrag berichten.
Immerhin „durfte“ ich das dann doch in meinem Buchbeitrag berichten. 
MfG,
Merkur
http://www.senckenberg.de/root/index.ph ... =2&id=4160
Die Originalarbeit:
Seifert, B., Fiedler, P. and Schultz, R. (2016), Escape to the high canopy – thermal deficiency causes niche expansion in a forest-floor ant. Insect Science. doi: 10.1111/1744-7917.12351
Die Autoren hatten erhebliche Probleme, ihren Beitrag in einer passenden Zeitschrift unterzubringen: Etliche Gutachter „konnten sich einfach nicht vorstellen“, dass so etwas möglich ist, und haben die Annahme abgelehnt. Auch das gibt es in der Forschung.

Mir wollte ein Gutachter mit derselben Begründung mal nicht glauben, dass die kleinen Gastameisen (Formicoxenus nitidulus) die großen Waldameisen (Formica rufa - Gruppe) direkt um Futter anbetteln können. Dabei hatte ich 1966 in der Schweiz persönlich mitgewirkt, dieses Verhalten in einem Fernsehfilm zeigen zu können.
 Immerhin „durfte“ ich das dann doch in meinem Buchbeitrag berichten.
Immerhin „durfte“ ich das dann doch in meinem Buchbeitrag berichten. 
MfG,
Merkur
- 4
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9944
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Unter seinen Kollegen und Studenten gilt er als der Schmerzensmann: Justin O. Schmidt, 69, Professor für Entomologie an der Universität von Arizona in Tucson, reist seit Jahrzehnten um die Welt und lässt sich im Namen der Wissenschaft von Wespen, Bienen und Ameisen stechen. Seine Rangliste der Insektenstichschmerzen, der „Schmidt Sting Pain Index“, genießt unter Forschern und Fans gleichermaßen Kultstatus. In seinem Buch „The Sting of the Wild“ erzählt er die Geschichten hinter den Stichen.
https://www.welt.de/wissenschaft/articl ... meise.html

- 4
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
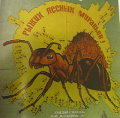
Reber - Moderator
- Beiträge: 1777
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3749
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Hier wurde der Index bereits einmal diskutiert:
https://www.ameisenforum.de/feuerameise ... ml#p345258
Ist wegen der Formatierungszeichen nur etwas schwer zu lesen.
MfG,
Merkur
https://www.ameisenforum.de/feuerameise ... ml#p345258
Ist wegen der Formatierungszeichen nur etwas schwer zu lesen.

MfG,
Merkur
- 1
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9944
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
DGaaE-Nachrichten 2016 – Berichte über Ameisen
Heft 1 des 30. Jahrgangs, August 2016, macht auf der Titelseite durch das Porträt einer Myrmecia nigrocincta aufmerksam. Das Heft enthält insbesondere Kurzberichte aus diversen Arbeitskreisen, darunter der Bericht zur Tagung des Arbeitskreises „Medizinische Arachno-Entomologie“ / Tagung der Deutschen Gesellschaft für medizinische Entomologie und Acarologie DGMEA (ab S. 25).Das Heft als PDF: http://www.dgaae.de/files/dgaae/downloa ... _1_web.pdf
Unter anderem geht es um:
- Die Vernachlässigte Ameise Lasius neglectus: Ausbreitung in Europa und
Rostock – eine Erfolgsstory.
- Importance of Ants (Formicidae) in Medical Entomology
“In Europe, only Monomorium pharaonis was identified as carrier of human
Pathogens”.
- Bedeutung von Lasius neglectus als mechanischer Vektor von Krankheitserregern.
(Die Art kommt in der Umgebung der Universitätsmedizin in Rostock vor. Die Möglichkeit der Übertragung von Krankheitserregern in den Klinikgebäuden wird untersucht).
- Ants Within Residences in the Netherlands.
(25 Ameisenarten wurden innerhalb von Häusern angetroffen. Die häufigste war Lasius brunneus).
- Lasius brunneus und Camponotus spez. in der Gebäudedämmung.
„Anhand von zwei praktischen Beispielen werden die Probleme bei der Lokalisierung
von Ameisenvölkern in der Gebäudedämmung sowie die meist eingeschränkten
Möglichkeiten zur Beseitigung von Nestern beschrieben. In vielen Fällen
können Baumängel in Verbindung mit Durchfeuchtung von Holz die Ursache für
die Besiedlung durch Ameisen sein“ – (Dazu habe ich hier im AP öfter berichtet).
- Ameisen in der Schweiz. Arten, Häufigkeiten, Probleme.
(Befasst sich u. a. ebenfalls mit Hausameisen, bes. Lasius brunneus. In der Südschweiz ist Crematogaster scutellaris lästig.)
Auf weitere drei Beiträge sei verwiesen.
MfG,
Merkur
- 2
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9944
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Ameisen: Die heimliche Weltmacht
Die Sendung "Einstein" des srf (Schweizer Radio und Fernsehen) widmete eine Sendung den Ameisen.
Gemäss Text ergründet "Einstein", wie die perfekte Transport- und Organisationsstruktur in der Kolonie funktioniert und "Einstein" trifft Bert Hölldobler in seinem Labor.
Die Sendung ist noch 28 Tage online.
http://www.srf.ch/sendungen/Einstein/ameisen-die-heimliche-weltmacht
Die Sendung "Einstein" des srf (Schweizer Radio und Fernsehen) widmete eine Sendung den Ameisen.
Gemäss Text ergründet "Einstein", wie die perfekte Transport- und Organisationsstruktur in der Kolonie funktioniert und "Einstein" trifft Bert Hölldobler in seinem Labor.
Die Sendung ist noch 28 Tage online.
http://www.srf.ch/sendungen/Einstein/ameisen-die-heimliche-weltmacht
- 3
- Mitbewohnerin
- Mitglied
- Beiträge: 7
- Registriert: Montag 1. September 2014, 22:41
- Bewertung: 34
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Danke für den Link!
Außerhalb der Schweiz kann man die Sendung unter diesem Link sehen:
Die Aufnahmen aus Bert Hölldobler's Labor stammen zumindest teilweise aus der Dokumentation "Ameisen - die heimliche Weltmacht", die sich hier in voller Länge findet:
Außerhalb der Schweiz kann man die Sendung unter diesem Link sehen:
Die Aufnahmen aus Bert Hölldobler's Labor stammen zumindest teilweise aus der Dokumentation "Ameisen - die heimliche Weltmacht", die sich hier in voller Länge findet:
- 2
- Maddio
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Liebe Ameisen – bitte draußen bleiben!
Beimerstetten: Toiletten auf Friedhof müssen wegen Ameisen saniert werden http://www.swp.de/ulm/lokales/alb_donau ... 85358.html
Man weiß nicht, welche Art (aber der Bericht deutet stark auf Lasius brunneus hin!- Merkur). Natürlich schreibt man „den Ameisen“ verallgemeinernd wieder allerlei „gute Taten“ zu, ohne zwischen (potentiellen) Schadameisen und anderen zu unterscheiden:
Merkur
Beimerstetten: Toiletten auf Friedhof müssen wegen Ameisen saniert werden http://www.swp.de/ulm/lokales/alb_donau ... 85358.html
Man weiß nicht, welche Art (aber der Bericht deutet stark auf Lasius brunneus hin!- Merkur). Natürlich schreibt man „den Ameisen“ verallgemeinernd wieder allerlei „gute Taten“ zu, ohne zwischen (potentiellen) Schadameisen und anderen zu unterscheiden:
MfG,In Deutschland gibt es etwa 115 verschiedene Ameisenarten: Rossameise, Schwarze Holzameise, Zweifarbige Wegameise, Braune Wegameise, Rasenameise, Rote Gartenameise, um nur einige zu nennen. Im Haus sind sie nicht gerne gesehen, richten sie doch an Holz und Dämmung veritable Schäden an. Siehe die Beimerstetter Friedhofstoiletten. Dabei sind Ameisen ausgesprochen wichtig für das Ökosystem. Sie beseitigen pflanzliche Abfälle und tote Tiere, verspeisen Eier von Insekten und Schnecken, schleppen kleine Raupen ins Nest und halten den Boden locker. Nicht zuletzt spielen sie bei der Verbreitung von Samen eine wichtige Rolle. Die fleißigen Tierchen sollten also im Garten – auf jeden Fall aber draußen – bleiben, um Gutes zu tun.
Merkur
- 2
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9944
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Wanderameisen-Arbeiter haben die Chance, die Königin zu befruchten. 
Man stößt immer wieder auf Verwunderliches!
Im Heft 5/2017 des GEO-Magazins, S. 103, liest man: „Der Forscher Daniel Kronauer ließ in einem Experiment Treiberameisen durch Genmanipulation zu Einzelgängern werden – und störte damit das Gefüge ihres ganzen Staates…“ – Leider ohne Quellenangabe.
Verwundert bin ich, dass danach bei Ameisen bereits Genmanipulation erfolgt sein soll. (Vielleicht weiß einer der User mehr dazu?)
Auf der Suche nach weiteren Informationen, Daniel J. C. Kronauer ist ein renommierter Ameisenforscher, grub ich einen Zeitungsbericht von der FAZ aus, vom 24. 11. 2009:
http://www.faz.net/aktuell/wissen/natur ... 84166.html
Soziale Insekten
Die Armee der Adoptierten
Merkwürdig, sehr merkwürdig.

MfG,
Merkur

Man stößt immer wieder auf Verwunderliches!
Im Heft 5/2017 des GEO-Magazins, S. 103, liest man: „Der Forscher Daniel Kronauer ließ in einem Experiment Treiberameisen durch Genmanipulation zu Einzelgängern werden – und störte damit das Gefüge ihres ganzen Staates…“ – Leider ohne Quellenangabe.
Verwundert bin ich, dass danach bei Ameisen bereits Genmanipulation erfolgt sein soll. (Vielleicht weiß einer der User mehr dazu?)

Auf der Suche nach weiteren Informationen, Daniel J. C. Kronauer ist ein renommierter Ameisenforscher, grub ich einen Zeitungsbericht von der FAZ aus, vom 24. 11. 2009:
http://www.faz.net/aktuell/wissen/natur ... 84166.html
Soziale Insekten
Die Armee der Adoptierten
Soldaten der Wanderameisenvölker bilden gefürchtete Truppen. Aber wie sich nun zeigte, gibt es einen beständigen nachbarschaftlichen Austausch zwischen verschiedenen Völkern, der auch für eine gewisse genetische Verwandtschaft sorgt.
...
Genetischer Austausch
Daniel Kronauer von der Harvard-Universität, der seine Ameisenstudien in Würzburg begonnen hat, und Jacobus Boomsma von der Universität Kopenhagen haben jetzt herausgefunden, dass der nachbarschaftliche Austausch der Armeen bei afrikanischen Wanderameisen der Art Dorylus molestus offensichtlich gang und gäbe ist. Offensichtlich geht die Vermischung sogar so weit, dass jeder Soldat genetisch zumindest ein wenig mit anderen Soldaten seines neuen Volkes verwandt ist. Das berichten die beiden Forscher in den aktuellen "Proceedings" der Royal Society in London.
Soldaten keine Konkurrenz
Der Ameisenstaat, der den verwaisten Soldaten Unterschlupf bietet, kann andererseits ziemlich sicher sein, dass die Adoptierten ihnen nicht zur Konkurrenz in der Fortpflanzung werden. Denn während gewöhnliche Arbeiter durchaus hin und wieder die Chance haben, die Königin zu befruchten, ist diese Möglichkeit bei den Soldaten an der Front praktisch ausgeschlossen.
Merkwürdig, sehr merkwürdig.


MfG,
Merkur
- 0
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9944
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Verwundert bin ich, dass danach bei Ameisen bereits Genmanipulation erfolgt sein soll. (Vielleicht weiß einer der User mehr dazu?)
Da ich den Daniel Kronauer erst vor zwei Wochen getroffen habe, hier mal kurz mein Kommentar dazu. Seine Arbeitsgruppe an der Rockefeller Universität hat es tatsächlich geschafft über das CRISPR-Cas9 Verfahren (neue Gene-Editing Methodik die seit ein paar Jahren alles revolutioniert und eine Schlagzeile nach der anderen produziert!) die bei ihm gezüchteten Oocera biroi (früher noch Cerapachys) genetisch zu manipulieren. Es wurde ein unglaublicher Aufwand betrieben und es war nicht einfach, die Ameisen über Generationen zu züchten und dann noch die Eier zu manipulieren...
Soweit ich weiß, ist das Paper noch nicht offiziell publiziert, aber es ist schon durch die Medien gegeistert.
http://www.sciencemag.org/news/2017/03/ ... es-evolved
Über die für die Sozialität wichtigen Geruchsrezeptoren kann man z.B. in dieser Vorgängerstudie der gleichen Arbeitsgruppe lernen:
http://www.pnas.org/content/113/49/14091.abstract
Grüße, Phil
- 3
- Phil
- Mitglied
- Beiträge: 66
- Registriert: Freitag 18. April 2014, 13:15
- Bewertung: 203
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Vielen Dank, Phil!
Das beruhigt mich wenigstens etwas: Es gab tatsächlich vor diesem erst im März 2017 erschienen Beitrag keine genetische Manipulation bei Ameisen.
http://www.sciencemag.org/news/2017/03/ ... es-evolved
Mir schien es bisher auch praktisch unmöglich, eine solche mit normalen Ameisen zu erreichen, und schon gar nicht mit den üblichen Wander-, Heeres- oder Treiberameisen.
Der Beitrag erläutert, dass dazu eine Ameisenart erforderlich war mit sehr speziellen Eigenschaften: Das Versuchstier ist eine klonale Art, Ooceraea biroi, bei der es keine Königinnen gibt und keine Männchen, und bei der jede Arbeiterin Eier legt, die sich wiederum zu Arbeiterinnen entwickeln. Damit sind einzelne Eier genetischen Manipulationen zugänglich, und es lässt sich aus einem Ei eine ganze Kolonie genetisch identischer Individuen aufziehen. Wie schwierig auch das noch ist, kann man dem verlinkten Text entnehmen.
Jedenfalls ist der kurze Beitrag in GEO völlig ungeeignet, dem (üblicherweise gebildeten, aber doch nicht auf jedem Gebiet sonderlich kenntnisreichen) Leser eine sinnvolle Information zu vermitteln.
MfG,
Merkur
Das beruhigt mich wenigstens etwas: Es gab tatsächlich vor diesem erst im März 2017 erschienen Beitrag keine genetische Manipulation bei Ameisen.
http://www.sciencemag.org/news/2017/03/ ... es-evolved
Mir schien es bisher auch praktisch unmöglich, eine solche mit normalen Ameisen zu erreichen, und schon gar nicht mit den üblichen Wander-, Heeres- oder Treiberameisen.
Der Beitrag erläutert, dass dazu eine Ameisenart erforderlich war mit sehr speziellen Eigenschaften: Das Versuchstier ist eine klonale Art, Ooceraea biroi, bei der es keine Königinnen gibt und keine Männchen, und bei der jede Arbeiterin Eier legt, die sich wiederum zu Arbeiterinnen entwickeln. Damit sind einzelne Eier genetischen Manipulationen zugänglich, und es lässt sich aus einem Ei eine ganze Kolonie genetisch identischer Individuen aufziehen. Wie schwierig auch das noch ist, kann man dem verlinkten Text entnehmen.
Jedenfalls ist der kurze Beitrag in GEO völlig ungeeignet, dem (üblicherweise gebildeten, aber doch nicht auf jedem Gebiet sonderlich kenntnisreichen) Leser eine sinnvolle Information zu vermitteln.
MfG,
Merkur
- 2
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9944
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
The article isn't published yet. It is a preprint, not peer-reviewed version of February 28 and Science reviewed it on March 8. The final version isn't published yet.... and can include corrections.
- 1
Teleutotje
" Tell-oo-toat-yeh "
" I am who I am , I think ... "
" Tell-oo-toat-yeh "
" I am who I am , I think ... "
-

Teleutotje - Mitglied
- Beiträge: 1437
- Registriert: Freitag 1. August 2014, 18:01
- Wohnort: Nazareth, Belgium
- Bewertung: 1270
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Nicht jeder liest das GEO-Magazin. Ich erlaube mir daher, mal den Beitrag über die genmanipulierten Ameisen einzukopieren. Wir beziehen das Magazin von der ersten Ausgabe an (Oktober 1976); das zeigt, dass wir die Inhalte normalerweise durchaus schätzen, mit gelegentlichen Ausnahmen.
Ich habe die Seite etwas beschnitten (oben steht nur als Bezeichnung für die Rubrik “361°“).
Das Bild zeigt wohl eine Laborkolonie der „Treiberameisen“ Ooceraea biroi. Sie besteht nur aus Arbeiterinnen, die sich alle parthenogenetisch fortpflanzen können. Männchen und Königinnen gibt es nicht, auch keine Gamergaten. Von „komplexer Organisation“ kann da wohl eher nicht die Rede sein. Nach dem Text in Science news dürften die genetisch veränderten Individuen auch nicht gerade als Einzelgänger leben. Und dass „soziale Strukturen in der Biologie bereits in der DNS stecken“, ist auch nicht eben überraschend. – Der Bildtext ist jedenfalls sehr vereinfacht, eigentlich sogar irreführend!
MfG,
Merkur
Ich habe die Seite etwas beschnitten (oben steht nur als Bezeichnung für die Rubrik “361°“).
Das Bild zeigt wohl eine Laborkolonie der „Treiberameisen“ Ooceraea biroi. Sie besteht nur aus Arbeiterinnen, die sich alle parthenogenetisch fortpflanzen können. Männchen und Königinnen gibt es nicht, auch keine Gamergaten. Von „komplexer Organisation“ kann da wohl eher nicht die Rede sein. Nach dem Text in Science news dürften die genetisch veränderten Individuen auch nicht gerade als Einzelgänger leben. Und dass „soziale Strukturen in der Biologie bereits in der DNS stecken“, ist auch nicht eben überraschend. – Der Bildtext ist jedenfalls sehr vereinfacht, eigentlich sogar irreführend!
MfG,
Merkur
- 1
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9944
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Fernsehtipp zur Argentinischen Ameise [Linepithema humile]:
Planet Wissen: Die Ameise - das größte Raubtier der Welt / WDR / Montag, 12.06.2017 / 14:00
Gäste: Prof. Dr. Jürgen Heinze, Evolutionsbiologe , Prof. Dr. Susanne Foitzik, Verhaltensbiologin
Aus dem Teaser zur Sendung:
Link zur Quelle, weiteren Sendezeiten und zur Mediathek, falls ihr die Sendung nach Ausstrahlung lieber online anschauen wollt:
https://www.wdr.de/programmvorschau/wdr ... -welt.html
Planet Wissen: Die Ameise - das größte Raubtier der Welt / WDR / Montag, 12.06.2017 / 14:00
Gäste: Prof. Dr. Jürgen Heinze, Evolutionsbiologe , Prof. Dr. Susanne Foitzik, Verhaltensbiologin
Aus dem Teaser zur Sendung:
Ameisen spielen eine meist unterschätze, jedoch sehr wichtige Rolle für unser Ökosystem: Indem sie tote Tiere fressen, sind sie die Müllabfuhr der Natur, zudem belüften sie den Waldboden und verteilen Pflanzensamen. In Deutschland gibt es etwa 100 verschiedene Ameisenarten - doch diese Vielfalt ist bedroht, von einem der mächtigsten Organismen unseres Planeten, der vor mehr als 100 Jahren eingeschleppten Argentinischen Ameise.
Entlang der europäischen Mittelmeerküste haben die winzigen Argentinischen Ameisen während der vergangenen Jahrzehnte eine Kolonie biblischen Ausmaßes erschaffen. Sie erstreckt sich inzwischen über fast 6.000 Kilometer von Norditalien über Frankreich und Spanien bis nach Portugal. Milliarden von Arbeiterinnen bilden hier den größten Superorganismus der Welt. Sie kämpfen mit unglaublicher Aggressivität und vernichten alle heimischen Ameisenarten.
Wissenschaftler befürchten, dass die Argentinische Ameise das Potential hat, Ökosysteme auf der ganzen Welt zu verändern. Die Forscher versuchen daher, die Strategien der Argentinischen Ameisen zu entschlüsseln und ihren Einfluss auf die europäische Natur zu verstehen. Sie wollen Abwehrmaßnahmen ergreifen, bevor die Argentinischen Ameisen weiter nach Norden vordringen.
Link zur Quelle, weiteren Sendezeiten und zur Mediathek, falls ihr die Sendung nach Ausstrahlung lieber online anschauen wollt:
https://www.wdr.de/programmvorschau/wdr ... -welt.html
- 5
- Anon
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Korrektur: Auf der Website der Sendung steht 13 Uhr.
- 2
Life finds a way!
-

di4pr - Mitglied
- Beiträge: 71
- Registriert: Samstag 20. Mai 2017, 09:30
- Wohnort: Berlin
- Bewertung: 121
Re: Hinweise auf Ameisen in den Medien
Der Film selbst dürfte eine Wiederholung von 2013 sein: http://www.daserste.de/information/wiss ... n-100.html
Doch ist bestimmt interessant, was die Gäste dazu zu sagen haben!
MfG,
Merkur
Doch ist bestimmt interessant, was die Gäste dazu zu sagen haben!
MfG,
Merkur
- 1
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9944
Zurück zu Wissenschaft und Medien
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
