Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Zum Kommentar von Maddio » Fr Okt 21, 2016 4:45 pm: “Leichen von Lasius fuliginosus sollten auch Reaktionen hervorbringen.“
Das wurde in der Arbeit m. W. nicht untersucht. Also steht nichts darüber drin.
Aber ein Zitat einer evtl. existierenden Veröffentlichung dazu könnte eine "neue wiss. Erkenntnis" bringen.
MfG,
Merkur
Das wurde in der Arbeit m. W. nicht untersucht. Also steht nichts darüber drin.
Aber ein Zitat einer evtl. existierenden Veröffentlichung dazu könnte eine "neue wiss. Erkenntnis" bringen.
MfG,
Merkur
- 0
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9942
Re: Bilder/Videos des Tages
Deutsche Forscher haben entdeckt, dass die Ameisen-Art Philidris nagasau auf den Fidschi-Inseln Samen einer Epiphyten-Pflanze in der Rinde eines Baumes pflanzt und diese düngt. "Dafür" leben die Ameisen in den Hohlräumen der Pflanze und ernten ihren Nektar.
Artikel Standard
Link im Fachjournal "Nature Plants", bebildert
Artikel Standard
Link im Fachjournal "Nature Plants", bebildert
- 1
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
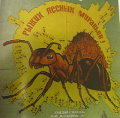
Reber - Moderator
- Beiträge: 1777
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3744
- blackbird1
- Mitglied
- Beiträge: 19
- Registriert: Donnerstag 22. September 2016, 11:23
- Bewertung: 39
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Hallo blackbird1,
Danke für´s einstellen!
Habe gesehen, Du hast im AF sogar noch einen deutschsprachigen Link zum Thema angefügt. Da der hier im AP ebenfalls lesenswert wäre: http://www.krone.at/wissen/ameisen-gebe ... ory-547821
.
Danke für´s einstellen!

Habe gesehen, Du hast im AF sogar noch einen deutschsprachigen Link zum Thema angefügt. Da der hier im AP ebenfalls lesenswert wäre: http://www.krone.at/wissen/ameisen-gebe ... ory-547821

.
- 3
- Anon
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Verhaltensforscher der Universität Edinburgh haben Experimente mit der Wüstenameise Cataglyphis velox durchgeführt um herauszufinden wie sich die Tiere anhand von Landmarken, Himmel, Sonnenstand, Geruch und Schrittzähler orientieren, bzw. wie sie diese Fähigkeiten kombinieren:
Artikel in der Zeit
How Ants Use Vision When Homing Backward
Sie schließen daraus, dass die Ameisen zwar auf ihr visuelles Gedächtnis angewiesen sind, um sich optimal zurechtzufinden. Können sie es aber gerade nicht nutzen, begreifen sie mit der Zeit aber auch mithilfe der anderen Techniken wie der Orientierung anhand des Himmels, dass sie sich im Weg irren. Für Tiere, die nicht einmal über ein echtes Gehirn verfügen, eine beachtliche Leistung.
Artikel in der Zeit
How Ants Use Vision When Homing Backward
- 3
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
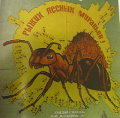
Reber - Moderator
- Beiträge: 1777
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3744
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Hier habe ich einen Diskussionsthread zu den "neuen wiss.Erkenntnissen" aufgemacht: viewtopic.php?f=23&t=1531&p=13474#p13474
MfG,
Merkur
MfG,
Merkur
- 0
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9942
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Twists and turns in der Verwendung von Stridulationssignalen
Passend zu unserer forenübergreifenden Diskussion über Evolution und Funktionen der Stridulation bei Ameisen bin ich auf die folgende Seite gestoßen:
http://derstandard.at/2000027650650/War ... rschrecken (20. Dezember 2015)
Forscher entdeckten ungewöhnliche Flirtstrategie bei Grillenarten aus der Unterfamilie Eneopterinae.
Originalarbeit: http://www.cell.com/current-biology/abs ... 60-9822(15)01358-5
MfG,
Merkur
Passend zu unserer forenübergreifenden Diskussion über Evolution und Funktionen der Stridulation bei Ameisen bin ich auf die folgende Seite gestoßen:
http://derstandard.at/2000027650650/War ... rschrecken (20. Dezember 2015)
Forscher entdeckten ungewöhnliche Flirtstrategie bei Grillenarten aus der Unterfamilie Eneopterinae.
Leipzig – Um einen Partner zu finden, verlassen sich viele Insektenarten auf akustische Signale – das gilt auch für Grillen. Bei verschiedenen Grillenarten aus der Unterfamilie Eneopterinae aus Südostasien und Neukaledonien entdeckte ein internationales Forscherteam nun aber eine überraschende Komponente in der Liebeskommunikation, die auf sehr ungewöhnlichem evolutionären Weg entstanden zu sein scheint. Typisch für die Tiere ist, dass Männchen mit ihren abendlichen Zirpkonzerten versuchen, Weibchen auf sich aufmerksam zu machen. Diese fühlen sich von den relativ tiefen Tönen des männlichen Lockgesangs angezogen und suchen dann den für sie attraktivsten Sänger zur Paarung auf.
"Hochfrequente Töne ab 10 Kilohertz lösen jedoch einen Schreckreflex aus, da dies bedeutet, dass die Grille möglicherweise von der Ultraschall-Echoortung einer hungrigen Fledermaus erfasst wurde", erklärt Stefan Schöneich von der Universität Leipzig, Koautor der Studie in "Current Biology". Verräterische Vibration In der Unterfamilie Eneopterinae jedoch begannen vor einigen Millionen Jahren die Grillenmännchen, diesen Umstand für ihren Vorteil auszunutzen. Anstatt zu warten, bis sich eine paarungsbereite Partnerin nähert, entwickelten sie die Strategie, durch zunehmend hochfrequentes Zirpen Weibchen zu erschrecken.
Durch das Zusammenzucken bei der Schreckreaktion entsteht ein kurzes Vibrationssignal, das den Männchen den Aufenthaltsort der Weibchen verrät. Im Laufe der weiteren Evolution haben diese Insekten daraus dann wieder eine echte Kommunikation entwickelt, von der beide Geschlechter profitieren: Die Weibchen haben die ursprüngliche Schreckreaktion verloren und antworten jetzt – gezielt an das Männchen ihrer Wahl adressiert – mit einer Vibration, um ihre Position mitzuteilen. "Das ist evolutionär sehr ungewöhnlich, dass ein ursprünglich aversives Signal nun zur Partnerfindung genutzt wird", sagt der Biologe, der seit Jahren die neuronalen Grundlagen des akustischen Verhalten von Insekten erforscht.
Originalarbeit: http://www.cell.com/current-biology/abs ... 60-9822(15)01358-5
MfG,
Merkur
- 3
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9942
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Dominanzhierarchien bei Ameisen: Was sind sie wert?
Auch in unseren Foren wird immer wieder von Dominanzhierarchien geschrieben, von (ökologisch) dominanten und dominierten (untergeordneten) Arten. Der neue Review-Artikel weckt Zweifel daran, wie aussagekräftig solche Angaben sind. Unterschiedliche Rangordnungen ergeben sich aus unterschiedlichen Bewertungsmethoden, und Hierarchien unter denselben Arten im selben Habitat können z.B. je nach Tageszeit verschieden ausfallen. - Im letzten Satz des Abstract empfehlen die Verfasser den Ameisen-Ökologen, von Dominanzhierarchien Abstand zu nehmen.
(Zum Verständnis: Es geht hier nicht um Dominazhierarchien unter Angehörigen eines Volkes, in deren Verhalten es zweifellos solche Rangordnungen gibt!)
https://myrmecologicalnews.org/cms/inde ... Itemid=406
DOMINANCE HIERARCHIES ARE A DOMINANT PARADIGM IN ANT ECOLOGY (HYMENOPTERA: FORMICIDAE), BUT SHOULD THEY BE? AND WHAT IS A DOMINANCE HIERARCHY ANYWAYS? - STUBLE, K.L., JURIĆ, I., CERDÁ, X. & SANDERS, N.J. Myrmecol. News 24: 71-81; printable; Online Earlier 25 January 2017
Abstract: There is a long tradition of community ecologists using interspecific dominance hierarchies as a way to explain species coexistence and community structure. However, there is considerable variation in the methods used to construct these hierarchies, how they are quantified, and how they are interpreted. In the study of ant communities, hierarchies are typically based on the outcome of aggressive encounters between species or on bait monopolization. These parameters are converted to rankings using a variety of methods ranging from calculating the proportion of fights won or baits monopolized to minimizing hierarchical reversals. However, we rarely stop to explore how dominance hierarchies relate to the spatial and temporal structure of ant communities, nor do we ask how different ranking methods quantitatively relate to one another. Here, through a review of the literature and new analyses of both published and unpublished data, we highlight some limitations of the use of dominance hierarchies, both in how they are constructed and how they are interpreted. We show that the most commonly used ranking methods can generate variation among hierarchies given the same data and that the results depend on sample size. Moreover, these ranks are not related to resource acquisition, suggesting limited ecological implications for dominance hierarchies. These limitations in the construction, analysis, and interpretation of dominance hierarchies lead us to suggest it may be time for ant ecologists to move on from dominance hierarchies.
MfG,
Merkur
Auch in unseren Foren wird immer wieder von Dominanzhierarchien geschrieben, von (ökologisch) dominanten und dominierten (untergeordneten) Arten. Der neue Review-Artikel weckt Zweifel daran, wie aussagekräftig solche Angaben sind. Unterschiedliche Rangordnungen ergeben sich aus unterschiedlichen Bewertungsmethoden, und Hierarchien unter denselben Arten im selben Habitat können z.B. je nach Tageszeit verschieden ausfallen. - Im letzten Satz des Abstract empfehlen die Verfasser den Ameisen-Ökologen, von Dominanzhierarchien Abstand zu nehmen.
(Zum Verständnis: Es geht hier nicht um Dominazhierarchien unter Angehörigen eines Volkes, in deren Verhalten es zweifellos solche Rangordnungen gibt!)
https://myrmecologicalnews.org/cms/inde ... Itemid=406
DOMINANCE HIERARCHIES ARE A DOMINANT PARADIGM IN ANT ECOLOGY (HYMENOPTERA: FORMICIDAE), BUT SHOULD THEY BE? AND WHAT IS A DOMINANCE HIERARCHY ANYWAYS? - STUBLE, K.L., JURIĆ, I., CERDÁ, X. & SANDERS, N.J. Myrmecol. News 24: 71-81; printable; Online Earlier 25 January 2017
Abstract: There is a long tradition of community ecologists using interspecific dominance hierarchies as a way to explain species coexistence and community structure. However, there is considerable variation in the methods used to construct these hierarchies, how they are quantified, and how they are interpreted. In the study of ant communities, hierarchies are typically based on the outcome of aggressive encounters between species or on bait monopolization. These parameters are converted to rankings using a variety of methods ranging from calculating the proportion of fights won or baits monopolized to minimizing hierarchical reversals. However, we rarely stop to explore how dominance hierarchies relate to the spatial and temporal structure of ant communities, nor do we ask how different ranking methods quantitatively relate to one another. Here, through a review of the literature and new analyses of both published and unpublished data, we highlight some limitations of the use of dominance hierarchies, both in how they are constructed and how they are interpreted. We show that the most commonly used ranking methods can generate variation among hierarchies given the same data and that the results depend on sample size. Moreover, these ranks are not related to resource acquisition, suggesting limited ecological implications for dominance hierarchies. These limitations in the construction, analysis, and interpretation of dominance hierarchies lead us to suggest it may be time for ant ecologists to move on from dominance hierarchies.
MfG,
Merkur
- 1
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9942
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Die Arbeit ist zwar nicht ganz neu, nämlich aus 2009 bereits, wie es aber manchmal so ist, stößt man eben mehr oder minder zufällig auf etwas interessantes und gerade die Brutpflege, die sich meist gut in den Kunstnestern betrachten läßt, um die geht es hier.
http://www.uni-wuerzburg.de/sonstiges/m ... /ameisen-f
http://www.uni-wuerzburg.de/sonstiges/m ... /ameisen-f
- 3
-

Trailandstreet - Mitglied
- Beiträge: 1174
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 21:02
- Wohnort: Ho'mbua
- Bewertung: 1693
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Über einen kleinen und sehr anhänglichen Käfer:
Quelle: https://www.tu-darmstadt.de/vorbeischau ... 056.de.jsp
Studie: https://bmczool.biomedcentral.com/artic ... 016-0010-x
Forscher der Technischen Universität Darmstadt und des National Museum of Natural History, Washington D.C., haben im Rahmen einer Biodiversitätsstudie eine neue Käferart entdeckt: Nymphister kronaueri lässt sich auf dem Rücken von Treiberameisen transportieren und sieht dabei deren Hinterteil täuschend ähnlich. Die in der Fachzeitschrift BMC Zoology veröffentlichte Studie zeigt, dass sich die neue Art mit ihren kräftigen Mandibeln an den Ameisen festhakt, und sich auf diese Weise gleichsam per Anhalter zum neuen Nistplatz der Ameisen transportieren lässt.
Dr. Christoph von Beeren, Fachbereich Biologie der TU Darmstadt, der Erstautor der Studie, beschreibt die Entdeckung: „Während wir Gäste bei einem nächtlichen Umzug der Wirtsameisen sammelten, bemerkten wir, dass die Hinterteile mancher Ameisen seltsam aussahen und das Licht unserer Stirnlampen anders reflektierten als die anderer Tiere. Von oben ist es schwierig, den Käfer zu entdecken, da er in Form und Größe dem Abdomen der Ameisen sehr ähnlich ist. Wenn man die Tiere aber von der Seite betrachtet, sieht es so aus, als hätte die Ameise zwei Hinterteile. Zu unserer Überraschung und Freude stellte sich das ,zweite Hinterteil‘ als neue Käferart heraus. Bei genauerer Betrachtung scheint auch die Feinstruktur der Kutikula eine Ähnlichkeit zu den Wirtsameisen aufzuweisen. Wir vermuten, dass die Käfer auf diese Weise eine Fremderkennung des Wirtes vermeiden können, und somit als unerkannte Gäste mitreisen.“ [..]
Quelle: https://www.tu-darmstadt.de/vorbeischau ... 056.de.jsp
Studie: https://bmczool.biomedcentral.com/artic ... 016-0010-x
- 4
- Anon
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Der neu beschriebene Heeresameisen-Parasit ist eine interessante Entdeckung, die Arbeit bietet die Gelegenheit, sich über die unglaubliche Vielfalt der mit Heeresameisen vergesellschafteten Ameisengäste und Parasiten zu informieren. So wurden mehrere Hundert Arten von Ameisengästen beschrieben, die allein mit der neotropischen Heeresameise Eciton burchellii zusammen leben!
Da ich selbst bei dem von Emse gezeigten Bild erst mal irrtümlich dachte, der Käfer insgesamt sehe einer Eciton doch auffallend ähnlich , füge ich hier die Seitenansicht aus der Originalarbeit ein. Da wird es deutlich, dass der Käfer nur das sackförmige Etwas über der Gaster der Ameise ist (in der Farbe der Ameise ähnlicher als deren Gaster!).
, füge ich hier die Seitenansicht aus der Originalarbeit ein. Da wird es deutlich, dass der Käfer nur das sackförmige Etwas über der Gaster der Ameise ist (in der Farbe der Ameise ähnlicher als deren Gaster!).
Anscheinend gibt es über die Lebensweise solcher Ameisengäste nicht sehr viele Informationen. Wie und wo treffen sich die Geschlechter, wo finden Paarung, Eiablage und Larvalentwicklung statt? Wovon ernähren sich die Larven?
Bei einer raschen Durchsicht der Literaturliste stieß ich auf:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1 ... 338.x/full
DNA identification and morphological description of the first confirmed larvae of Hetaeriinae (Coleoptera: Histeridae) von Michael S. Caterino, Alexey K. Tishechkin, 2006. (UF muss wohl Haeteriinae lauten).
Danach wurden Larven im Biwak von Heeresameisen gefunden. Die DNA-Analyse ist dabei ein wirklich wertvolles Hilfsmittel um die Zugehörigkeit der Larven zu einer bestimmten Art zu bestätigen. Dann taucht aber gleich die Frage auf, wie die jungen Käfer wieder zu den Ameisen gelangen. Ob die Heeresameisen bestimmte Biwakplätze häufiger nutzen? Oder finden die Käfer fliegend zu ihren Adultwirten? – Vielleicht gibt es dazu schon weitere Literatur?
Hinweis: In den Keywords des Originalartikels taucht der Begriff „social parasitism“ auf. Leider wird diese Bezeichnung oft in der sehr weiten Fassung verwendet, die alle Ameisengäste (Myrmecophile) sowie Ektoparasiten etc. einschließt. In der ursprünglichen und engen Fassung, die ich für klarer halte, sind Sozialparasiten nur soziale Arten, die andere soziale Arten parasitieren, deren soziale Leistungen nutzen, also sozialparasitische Wespen, Hummeln und vor allem Ameisen (Gastameisen, Sklavenhalter, temporäre und permanente Sozialparasiten).
MfG,
Merkur
Da ich selbst bei dem von Emse gezeigten Bild erst mal irrtümlich dachte, der Käfer insgesamt sehe einer Eciton doch auffallend ähnlich
 , füge ich hier die Seitenansicht aus der Originalarbeit ein. Da wird es deutlich, dass der Käfer nur das sackförmige Etwas über der Gaster der Ameise ist (in der Farbe der Ameise ähnlicher als deren Gaster!).
, füge ich hier die Seitenansicht aus der Originalarbeit ein. Da wird es deutlich, dass der Käfer nur das sackförmige Etwas über der Gaster der Ameise ist (in der Farbe der Ameise ähnlicher als deren Gaster!). Der Käfer gehört zu den Histeridae (Stutzkäfer), die überwiegend so rundliche Formen haben. Ihren deutschen Namen tragen sie, weil die Flügeldecken die Hinterleibsspitze nicht ganz erreichen und hinten wie abgestutzt wirken.
Anscheinend gibt es über die Lebensweise solcher Ameisengäste nicht sehr viele Informationen. Wie und wo treffen sich die Geschlechter, wo finden Paarung, Eiablage und Larvalentwicklung statt? Wovon ernähren sich die Larven?
Bei einer raschen Durchsicht der Literaturliste stieß ich auf:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1 ... 338.x/full
DNA identification and morphological description of the first confirmed larvae of Hetaeriinae (Coleoptera: Histeridae) von Michael S. Caterino, Alexey K. Tishechkin, 2006. (UF muss wohl Haeteriinae lauten).
Danach wurden Larven im Biwak von Heeresameisen gefunden. Die DNA-Analyse ist dabei ein wirklich wertvolles Hilfsmittel um die Zugehörigkeit der Larven zu einer bestimmten Art zu bestätigen. Dann taucht aber gleich die Frage auf, wie die jungen Käfer wieder zu den Ameisen gelangen. Ob die Heeresameisen bestimmte Biwakplätze häufiger nutzen? Oder finden die Käfer fliegend zu ihren Adultwirten? – Vielleicht gibt es dazu schon weitere Literatur?
Hinweis: In den Keywords des Originalartikels taucht der Begriff „social parasitism“ auf. Leider wird diese Bezeichnung oft in der sehr weiten Fassung verwendet, die alle Ameisengäste (Myrmecophile) sowie Ektoparasiten etc. einschließt. In der ursprünglichen und engen Fassung, die ich für klarer halte, sind Sozialparasiten nur soziale Arten, die andere soziale Arten parasitieren, deren soziale Leistungen nutzen, also sozialparasitische Wespen, Hummeln und vor allem Ameisen (Gastameisen, Sklavenhalter, temporäre und permanente Sozialparasiten).
MfG,
Merkur
- 4
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9942
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Ameisen-Antibiotika für Menschen?
http://www.pharmazeutische-zeitung.de/i ... p?id=67727
Eine baumbewohnende Ameise aus Kenia hat es über Nacht zur Berühmtheit gebracht: Tetraponera penzigi. Diesen Namen sollte man sich merken, zumindest wenn man sich für Antibiotika-Forschung interessiert. Die possierlichen Tierchen sind nämlich von der neu entdeckten Bakterienart Streptomyces formicae besiedelt, aus der Wissenschaftler des John Innes Centre und der University of East Anglia in Norwich die neue Antibiotika-Klasse der Formicamycine isolierten. In beiden Fällen stand die Ameise, Lateinisch formica, für den Namen Pate.
http://www.pharmazeutische-zeitung.de/i ... p?id=67727
- 2
„Doch vor allen Dingen:
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
Das worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“
-
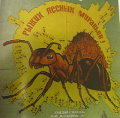
Reber - Moderator
- Beiträge: 1777
- Registriert: Mittwoch 9. April 2014, 15:31
- Wohnort: Bern
- Bewertung: 3744
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Eine weitere Forschung über Myrmecophile bei Wanderameisen:
Käfer leben als getarnte U-Boote im Ameisenstaat
Ganzer Artikel: http://derstandard.at/2000054243715/Kae ... eisenstaat
Abstract: Deep-Time Convergence in Rove Beetle Symbionts of Army Ants
Käfer leben als getarnte U-Boote im Ameisenstaat
"Mit Wanderameisen ist nicht zu spaßen: Die tropischen Räuber ziehen als gewaltige Streitmacht durch den Dschungel und greifen alles an, was ihnen vor die kräftigen Kiefer kommt. Als Insekt tut man also gut daran, ihnen so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen – außer man zählt zu jener Gruppe von furchtlosen Käfern, die gleichsam verkleidet mitten unter den aggressiven Ameisen lebt und sich sogar von ihrem Nachwuchs ernährt."
"Ein Team um Joseph Parker von der Columbia University (New York) und Munetoshi Maruyama vom Kyushu University Museum (Fukuoka, Japan) hat zwölf nicht näher miteinander verwandte Spezies dieser zu den Kurzflüglern zählenden Käfer in zahlreichen Ameisenstaaten entdeckt. [..] Parker und seine Kollegen sehen darin ein herausragendes Beispiel für konvergente Evolution. Wie DNA-Analysen zeigten, lebte der letzte gemeinsame Verwandte der zwölf untersuchten Kurzflüglerarten bereits vor rund 105 Millionen Jahren. Die Lebensweise in der Ameisenkolonie hat sich bei diesen Insekten demnach mehrfach unabhängig voneinander entwickelt. Das deutet nach Ansicht der Forscher darauf hin, dass die Evolution stets ähnliche Wege beschreitet, sobald bestimmte Szenarien dies erlauben."
"Die treibende evolutionäre Kraft dahinter bleibt allerdings unklar – so wie überhaupt noch sehr viele Fragen rund um die Käfer-U-Boote offen sind. Beispielsweise wollen die Wissenschafter noch klären, ob das Arrangement vielleicht doch nicht so einseitig ist, wie es den Anschein hat. "Möglicherweise produzieren die Käfer in ihren Drüsen eine Substanz, die für die Ameisen interessant ist", vermutet Parker. "Oder die Käfer ernähren sich auch von Milben, die auf den Ameisen leben." [..]
Ganzer Artikel: http://derstandard.at/2000054243715/Kae ... eisenstaat
Abstract: Deep-Time Convergence in Rove Beetle Symbionts of Army Ants
- 3
- Anon
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Zu dem von Emse verlinkten Artikel über die Gastkäfer bei Heeresameisen:

MfG,
Merkur
Zurzeit habe ich oft den Eindruck, dass Biodiversitätsforscher mit viel Aufwand immer mehr neue Arten beschreiben (nicht nur bei Ameisen und deren Gästen etc.), dass aber die Aufklärung der Lebensweise solcher Arten, ihrer besonderen An- und Einpassungen in die Biozönose, stark hinterher hinkt. Dabei besteht Biodiversität nicht nur aus der Anzahl von Arten in einem Habitat, sondern umfasst die mindestens ebenso bedeutsamen und vielfältigen („diversen“) Wechselbeziehungen zwischen den Arten. – Mit jeder neu entdeckten Art öffnet sich ein oft weites Feld von Fragen, deren Beantwortung noch (viel) mehr Aufwand erfordert als die reine Identifikation einer Art als solcher. - Nur so als Hinweis!„Auch was die Lebensumstände der Ameisen-Imitatoren betrifft, gibt es noch einiges zu entdecken. Als nächstes wollen Parker und sein Team herausfinden, wie die Kurzflügler im Gewusel ihrer Wirte einen Paarungspartner finden, wo sie ihre Eier ablegen und wie ihre Larven aufwachsen. Vorerst jedoch hat man noch nicht einmal eine Ahnung, wie diese aussehen könnten.“

MfG,
Merkur
- 1
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9942
Ameisen sind schon länger Landwirte als der Mensch
US-Biologen beschreiben jetzt in den Proceedings of the Royal Society B, wie die Insekten das Verhalten entwickelt und mit der Zeit verfeinert haben. Demnach kultivierten die ersten Farmer-Ameisen Pilze in Regenwäldern, wo diese auch alleine in freier Natur überleben konnten. Vor etwa 30 Millionen Jahren begannen Ameisen dann damit, Pilze in trockenen Regionen zu halten. Mit der Zeit waren die Pilze in den unwirtlichen Lebensräumen ohne die Pflege der Ameisen nicht mehr überlebensfähig und von diesen abhängig.
Die Forscher erstellten anhand genetischer Daten einen Stammbaum von etwa 120 Ameisen-Arten aus trockenen und feuchten Lebensräumen – der Großteil davon pilzzüchtend. Die Untersuchungen bestätigten die Vermutung, dass die Pilzzucht der Insekten in südamerikanischen Regenwäldern begann. Außerdem zeigte sich, dass die eigentliche Domestikation der Pilze in trockenen Gebieten stattfand, wo diese über lange Zeit isoliert mit den Ameisen lebten. http://www.deutschlandfunk.de/pilzzucht ... _id=732559
Dry habitats were crucibles of domestication in the evolution of agriculture in ants / Published 12 April 2017
http://rspb.royalsocietypublishing.org/ ... 2/20170095
- 3
- Anon
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Merkur hat geschrieben:Der neu beschriebene Heeresameisen-Parasit ist eine interessante Entdeckung, die Arbeit bietet die Gelegenheit, sich über die unglaubliche Vielfalt der mit Heeresameisen vergesellschafteten Ameisengäste und Parasiten zu informieren. So wurden mehrere Hundert Arten von Ameisengästen beschrieben, die allein mit der neotropischen Heeresameise Eciton burchellii zusammen leben!
Da ich selbst bei dem von Emse gezeigten Bild erst mal irrtümlich dachte, der Käfer insgesamt sehe einer Eciton doch auffallend ähnlich, füge ich hier die Seitenansicht aus der Originalarbeit ein. Da wird es deutlich, dass der Käfer nur das sackförmige Etwas über der Gaster der Ameise ist (in der Farbe der Ameise ähnlicher als deren Gaster!).
Der Käfer gehört zu den Histeridae (Stutzkäfer), die überwiegend so rundliche Formen haben. Ihren deutschen Namen tragen sie, weil die Flügeldecken die Hinterleibsspitze nicht ganz erreichen und hinten wie abgestutzt wirken.
Anscheinend gibt es über die Lebensweise solcher Ameisengäste nicht sehr viele Informationen. Wie und wo treffen sich die Geschlechter, wo finden Paarung, Eiablage und Larvalentwicklung statt? Wovon ernähren sich die Larven?
Bei einer raschen Durchsicht der Literaturliste stieß ich auf:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1 ... 338.x/full
DNA identification and morphological description of the first confirmed larvae of Hetaeriinae (Coleoptera: Histeridae) von Michael S. Caterino, Alexey K. Tishechkin, 2006. (UF muss wohl Haeteriinae lauten).
Danach wurden Larven im Biwak von Heeresameisen gefunden. Die DNA-Analyse ist dabei ein wirklich wertvolles Hilfsmittel um die Zugehörigkeit der Larven zu einer bestimmten Art zu bestätigen. Dann taucht aber gleich die Frage auf, wie die jungen Käfer wieder zu den Ameisen gelangen. Ob die Heeresameisen bestimmte Biwakplätze häufiger nutzen? Oder finden die Käfer fliegend zu ihren Adultwirten? – Vielleicht gibt es dazu schon weitere Literatur?
Hinweis: In den Keywords des Originalartikels taucht der Begriff „social parasitism“ auf. Leider wird diese Bezeichnung oft in der sehr weiten Fassung verwendet, die alle Ameisengäste (Myrmecophile) sowie Ektoparasiten etc. einschließt. In der ursprünglichen und engen Fassung, die ich für klarer halte, sind Sozialparasiten nur soziale Arten, die andere soziale Arten parasitieren, deren soziale Leistungen nutzen, also sozialparasitische Wespen, Hummeln und vor allem Ameisen (Gastameisen, Sklavenhalter, temporäre und permanente Sozialparasiten).
MfG,
Merkur
Phil hat im eusozial einen "Nachtisch" zu der Geschichte gepostet, einen Bericht aus der taz.

MfG,
Merkur
- 2
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9942
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Übrigens hab ich in unserem "Bild des Tages"-Thread vor kurzen ein Bild des Käfers gepostet: http://forum.eusozial.de/index.php?thre ... #post40489 Ein Video von mir folgt hoffentlich auch bald.
ich will noch nicht zuviel verraten, aber wir haben den Käfer beim Abflug beobachtet Gibt bald mehr Infos.
Gibt bald mehr Infos.
Grüße, Phil
Dann taucht aber gleich die Frage auf, wie die jungen Käfer wieder zu den Ameisen gelangen. Ob die Heeresameisen bestimmte Biwakplätze häufiger nutzen? Oder finden die Käfer fliegend zu ihren Adultwirten? – Vielleicht gibt es dazu schon weitere Literatur?
ich will noch nicht zuviel verraten, aber wir haben den Käfer beim Abflug beobachtet
 Gibt bald mehr Infos.
Gibt bald mehr Infos.Grüße, Phil
- 4
- Phil
- Mitglied
- Beiträge: 66
- Registriert: Freitag 18. April 2014, 13:15
- Bewertung: 203
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Wie sich Sklavenhalter-Ameisen über ihren (nicht vorhandenen) Geruch "unsichtbar" machen:
Quelle: http://derstandard.at/2000056525630/Skl ... unsichtbar
Paper: The influence of slavemaking lifestyle, caste and sex on chemical profiles in Temnothorax ants: insights into the evolution of cuticular hydrocarbons / http://rspb.royalsocietypublishing.org/ ... ticle-info
Manche Ameisenarten, darunter etwa Vertreter der Gattung Temnothorax, gehen – zumindest aus menschlicher Sicht – geradezu brutal gegen andere Ameisenkolonien nahe verwandter Arten vor: Sie überfallen regelmäßig die fremden Nester, töten die erwachsenen Tiere, stehlen die Brut und halten sich diese als Arbeitssklaven. Um bei ihren Raubzügen unerkannt zu bleiben, haben sich diese Ameisen eine regelrechte Tarnkappe zugelegt: Wie deutsche Wissenschafter nun herausgefunden haben, tragen sie auf ihrer Körperoberfläche kaum informative Duftsignale, weshalb sie von ihren Opfern nicht erkannt werden. [..]
Quelle: http://derstandard.at/2000056525630/Skl ... unsichtbar
Paper: The influence of slavemaking lifestyle, caste and sex on chemical profiles in Temnothorax ants: insights into the evolution of cuticular hydrocarbons / http://rspb.royalsocietypublishing.org/ ... ticle-info
- 3
- Anon
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Nach Infektion mit einem Krankheitserreger verstärken Ameisenköniginnen ihren Fortpflanzungs-Aufwand.
Julia Giehr, Anna V. Grasse, Sylvia Cremer, Jürgen Heinze, Alexandra Schrempf (2017): Ant queens increase their reproductive efforts after pathogen infection. Royal Society Open Science 4(7):170547 DOI: 10.1098/rsos.170547
http://rsos.royalsocietypublishing.org/ ... 4/7/170547
Abstract
Infections with potentially lethal pathogens may negatively affect an individual’s lifespan and decrease its reproductive value. The terminal investment hypothesis predicts that individuals faced with a reduced survival should invest more into reproduction instead of maintenance and growth. Several studies suggest that individuals are indeed able to estimate their body condition and to increase their reproductive effort with approaching death, while other studies gave ambiguous results. We investigate whether queens of a perennial social insect (ant) are able to boost their reproduction following infection with an obligate killing pathogen. Social insect queens are special with regard to reproduction and aging, as they outlive conspecific non-reproductive workers. Moreover, in the ant Cardiocondyla obscurior, fecundity increases with queen age. However, it remained unclear whether this reflects negative reproductive senescence or terminal investment in response to approaching death. Here, we test whether queens of C. obscurior react to infection with the entomopathogenic fungus Metarhizium brunneum by an increased egg-laying rate. We show that a fungal infection triggers a reinforced investment in reproduction in queens. This adjustment of the reproductive rate by ant queens is consistent with predictions of the terminal investment hypothesis and is reported for the first time in a social insect.
Man sollte erwarten, dass Ameisenköniginnen bei einer potenziell tödlichen Infektion ihre Eiablagerate allmählich reduzieren. Doch das Gegenteil ist der Fall: In der Arbeit wird am Beispiel der Ameise Cardiocondyla obscurior gezeigt, dass die Königinnen nach Infektion mit dem entomopathogenen (bei Insekten Krankheit erregenden) Pilz Metrhizium brunneum ihre Eiablagerate steigern. Der Pilz löst bei den Königinnen ein erhöhtes Investment in die Fortpflanzung aus. (Dann allerdings sterben sie vor Erreichen ihrer normalen Lebenserwartung).
Das Ergebnis stimmt überein mit einer bereits anhand anderer Organismen formulierten Hypothese, wonach Individuen angesichts einer verringerten Überlebenschance bevorzugt in die Fortpflanzung investieren sollten anstatt in Selbsterhaltung und Wachstum. Nach einigen Untersuchungen sind Individuen in der Lage, ihren körperlichen Zustand einzuschätzen und mit dem Näherrücken des Todes ihre Fortpflanzungsbemühungen zu steigern. Andere Untersuchungen erbrachten zweideutige oder gegenteilige Ergebnisse.
Bei C. obscurior steigt die Fruchtbarkeit ohnehin mit zunehmendem Alter, einer Hypothese zufolge als Reaktion auf den näher kommenden Tod. Erstmals wird in dieser Arbeit bei einem sozialen Insekt gezeigt, dass auch eine Pilzinfektion bei Königinnen ein erhöhtes Investment in die Fortpflanzung auslöst.
--
Mein Kommentar: Das Ganze ist komplizierter, als es in einem Abstract dargestellt werden kann. Für das experimentelle Vorgehen muss man die Originalarbeit lesen.
Die durchschnittliche Lebensdauer der Königinnen liegt bei nur 26 Wochen, die Völker sind klein (um 100 Arbeiterinnen). Damit lässt sich in vernünftigen Zeiträumen experimentieren!
Gesteigerte Fortpflanzungsrate (Produktion von Eiern) tritt natürlich mit wachsender Arbeiterinnenzahl ein, doch wurde im Experiment die Zahl der Arbeiterinnen konstant gehalten. - Mich erinnert die „terminal investment hypothesis“ an die „Notreife“ mancher Früchte und Samen unter ungünstigen Bedingungen, oder auch an Kräuter, die abhängig von Wasser-, Nährstoff- und Lichtgenuss entweder sehr groß werden und erst dann üppig blühen, oder als kleine Pflänzchen bereits wenige Blüten ansetzen und fruchten.
Wie weit die Befunde an Cardiocondyla obscurior auf andere Ameisen übertragbar sind, ist jetzt natürlich noch nicht zu sagen. Bei einer von Ameisenhaltern gelegentlich geplanten Begrenzung des Wachstums von Ameisenkolonien, z.B. durch Mangelernährung, könnte unter Umständen auch verfrühte Produktion von Geschlechtstiere resultieren.
MfG,
Merkur
Julia Giehr, Anna V. Grasse, Sylvia Cremer, Jürgen Heinze, Alexandra Schrempf (2017): Ant queens increase their reproductive efforts after pathogen infection. Royal Society Open Science 4(7):170547 DOI: 10.1098/rsos.170547
http://rsos.royalsocietypublishing.org/ ... 4/7/170547
Abstract
Infections with potentially lethal pathogens may negatively affect an individual’s lifespan and decrease its reproductive value. The terminal investment hypothesis predicts that individuals faced with a reduced survival should invest more into reproduction instead of maintenance and growth. Several studies suggest that individuals are indeed able to estimate their body condition and to increase their reproductive effort with approaching death, while other studies gave ambiguous results. We investigate whether queens of a perennial social insect (ant) are able to boost their reproduction following infection with an obligate killing pathogen. Social insect queens are special with regard to reproduction and aging, as they outlive conspecific non-reproductive workers. Moreover, in the ant Cardiocondyla obscurior, fecundity increases with queen age. However, it remained unclear whether this reflects negative reproductive senescence or terminal investment in response to approaching death. Here, we test whether queens of C. obscurior react to infection with the entomopathogenic fungus Metarhizium brunneum by an increased egg-laying rate. We show that a fungal infection triggers a reinforced investment in reproduction in queens. This adjustment of the reproductive rate by ant queens is consistent with predictions of the terminal investment hypothesis and is reported for the first time in a social insect.
Man sollte erwarten, dass Ameisenköniginnen bei einer potenziell tödlichen Infektion ihre Eiablagerate allmählich reduzieren. Doch das Gegenteil ist der Fall: In der Arbeit wird am Beispiel der Ameise Cardiocondyla obscurior gezeigt, dass die Königinnen nach Infektion mit dem entomopathogenen (bei Insekten Krankheit erregenden) Pilz Metrhizium brunneum ihre Eiablagerate steigern. Der Pilz löst bei den Königinnen ein erhöhtes Investment in die Fortpflanzung aus. (Dann allerdings sterben sie vor Erreichen ihrer normalen Lebenserwartung).
Das Ergebnis stimmt überein mit einer bereits anhand anderer Organismen formulierten Hypothese, wonach Individuen angesichts einer verringerten Überlebenschance bevorzugt in die Fortpflanzung investieren sollten anstatt in Selbsterhaltung und Wachstum. Nach einigen Untersuchungen sind Individuen in der Lage, ihren körperlichen Zustand einzuschätzen und mit dem Näherrücken des Todes ihre Fortpflanzungsbemühungen zu steigern. Andere Untersuchungen erbrachten zweideutige oder gegenteilige Ergebnisse.
Bei C. obscurior steigt die Fruchtbarkeit ohnehin mit zunehmendem Alter, einer Hypothese zufolge als Reaktion auf den näher kommenden Tod. Erstmals wird in dieser Arbeit bei einem sozialen Insekt gezeigt, dass auch eine Pilzinfektion bei Königinnen ein erhöhtes Investment in die Fortpflanzung auslöst.
--
Mein Kommentar: Das Ganze ist komplizierter, als es in einem Abstract dargestellt werden kann. Für das experimentelle Vorgehen muss man die Originalarbeit lesen.
Die durchschnittliche Lebensdauer der Königinnen liegt bei nur 26 Wochen, die Völker sind klein (um 100 Arbeiterinnen). Damit lässt sich in vernünftigen Zeiträumen experimentieren!
Gesteigerte Fortpflanzungsrate (Produktion von Eiern) tritt natürlich mit wachsender Arbeiterinnenzahl ein, doch wurde im Experiment die Zahl der Arbeiterinnen konstant gehalten. - Mich erinnert die „terminal investment hypothesis“ an die „Notreife“ mancher Früchte und Samen unter ungünstigen Bedingungen, oder auch an Kräuter, die abhängig von Wasser-, Nährstoff- und Lichtgenuss entweder sehr groß werden und erst dann üppig blühen, oder als kleine Pflänzchen bereits wenige Blüten ansetzen und fruchten.
Wie weit die Befunde an Cardiocondyla obscurior auf andere Ameisen übertragbar sind, ist jetzt natürlich noch nicht zu sagen. Bei einer von Ameisenhaltern gelegentlich geplanten Begrenzung des Wachstums von Ameisenkolonien, z.B. durch Mangelernährung, könnte unter Umständen auch verfrühte Produktion von Geschlechtstiere resultieren.
MfG,
Merkur
- 5
-

Merkur - Beirat
- Beiträge: 3673
- Registriert: Sonntag 6. April 2014, 07:52
- Wohnort: Reinheim
- Bewertung: 9942
Re: Ameisen: Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
Mechanik von Solenopsis invicta
Gerade bei Eusozial entdeckt: http://forum.eusozial.de/index.php?thread/2199-science-update-related-to-ants-other-hymenoptera/&postID=41317#post41317
Man kennt das ja aus der Literatur. Aber faszinierend, diese Eigenschaften so vorgeführt zu sehen.
Hier noch Links zum Thema:
http://www.antphysics.gatech.edu/
https://blogs.scientificamerican.com/cocktail-party-physics/tunnel-vision-probing-the-physics-of-fire-ants/
Wer etwas weiß, gern mehr davon!
Gerade bei Eusozial entdeckt: http://forum.eusozial.de/index.php?thread/2199-science-update-related-to-ants-other-hymenoptera/&postID=41317#post41317
Man kennt das ja aus der Literatur. Aber faszinierend, diese Eigenschaften so vorgeführt zu sehen.
Hier noch Links zum Thema:
http://www.antphysics.gatech.edu/
https://blogs.scientificamerican.com/cocktail-party-physics/tunnel-vision-probing-the-physics-of-fire-ants/
Wer etwas weiß, gern mehr davon!
- 2
Life finds a way!
-

di4pr - Mitglied
- Beiträge: 71
- Registriert: Samstag 20. Mai 2017, 09:30
- Wohnort: Berlin
- Bewertung: 121
Zurück zu Wissenschaft und Medien
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
